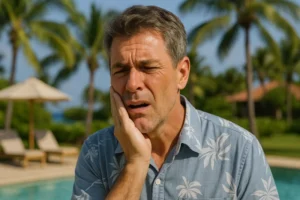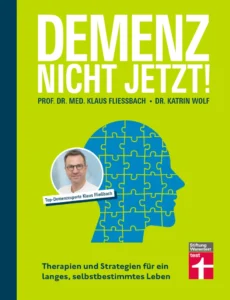#Gewinner#Der Schwerpunkt der ausgezeichneten Arbeiten lag bei Konzepten, die sich mit der Verbesserung der Mundgesundheit gerade bei Gruppen, in denen Karies ein besonderes Problem darstellt, befassten. Prämiert wurden direkt und kostengünstig realisierbare Prophylaxeprogramme. So entwickelten drei der vier prämierten Arbeiten Strategien zur Schulung von Pflegepersonal bzw. Schülern, um die oft vernachlässigte Zahnpflege von Senioren in Altenheimen, Menschen mit Behinderungen sowie sozial benachteiligten Kindern nachhaltig zu verbessern. Eine weitere Arbeit untersuchte das kariogene Potenzial probiotischer und kariogener Laktobazillen.
Erster Platz: Prophylaxe-Intervention in Altenheimen
(PD Dr. Alexander Hassel, Dr. Anke Dieke, Dr. Reinhard Dieke, Prof. Dr. Peter Rammelsberg)
#Hassel#Den ersten Platz (Dotierung: 4.000 Euro) belegte das Team um Dr. Alexander Hassel, Heidelberg. Eine dreimonatige kontrollierte Interventionsstudie an acht Altenheimen ergab: Durch regelmäßige professionelle Zahn- und Prothesenreinigungen sowie Mundhygiene-Instruktionen durch das Pflegepersonal ließ sich die Mundgesundheit der Heimsenioren deutlich verbessern, was positive Effekte auf den Ernährungszustand und auch das Allgemeinbefinden der Betreuten erwarten lässt. Die Forderung der Studie: alle drei Monate professionelle Zahn- bzw. Prothesenreinigungen.
Deutschland befindet sich auf dem Weg in eine alternde Gesellschaft. Diese zunehmende Langlebigkeit stellt unsere Gesellschaft vor die Herausforderung, das Erreichen eines hohen Lebensalters in psychisch-physischem Wohlbefinden zu ermöglichen. Dazu tragen auch ganz entscheidend die Zahn- und Mundgesundheit bei. Eine besondere Gruppe von Patienten stellen die in Altenheimen lebenden, oft pflegebedürftigen älteren Menschen dar. Viele zahnmedizinische Studien belegen einen völlig inadäquaten Zustand bezüglich der Mund- und Prothesenhygiene sowie der prothetischen Versorgungsgrade bei Heimbewohnern. Besonders sei auf den mangelhaften Zustand bei der Prothesenhygiene hingewiesen. Die große Mehrzahl der Senioren hat Zahnersatz, jedoch sind die wenigsten individuell instruiert worden. Die Situation wird zusätzlich dadurch verschärft, dass die Regelmäßigkeit der Zahnarztbesuche gerade bei in Heimen lebenden älteren Menschen drastisch sinkt. Diese schlechte Mundgesundheitssituation hat nicht nur direkte orale Folgen. Negative Beeinflussung durch schlechte Mundgesundheit erfährt auch die Ernährungssituation, die Lebensqualität und die Allgemeingesundheit. Obwohl der schlechte Mundgesundheitszustand bereits seit Jahrzehnten bekannt ist und aufgrund der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung mit steigendem Anteil älterer Menschen ein rapides Anwachsen dieser Risikogruppe zu erwarten ist, wurden bisher keine alltagstauglichen Strategien entwickelt, um diesem Vorgang entgegen zu wirken. Es besteht folglich die dringende Notwendigkeit zur Erarbeitung von Strategien und Prophylaxekonzepten.
Ziel dieser Interventionsstudie war es daher, ein praktikables Konzept zur Verbesserung der Mundgesundheit für ältere Menschen in Heimen zu erarbeiten. Die Studie wurde in acht Seniorenheimen mit 102 freiwillig teilnehmenden Senioren niedriger Pflegestufen durchgeführt. Der Datenerhebungszeitraum betrug pro Studienteilnehmer 3 Monate und beinhaltete jeweils vier zahnärztliche Untersuchungen. Die Studie war als randomisierte, verblindete und kontrollierte klinische Interventionsstudie mit drei Therapiegruppen und einer Kontrollgruppe ausgelegt. Ein Zahnarzt führte alle Untersuchungen einschließlich der Befragungen durch, ohne die Zugehörigkeit der Probanden zu den jeweiligen Gruppen zu kennen. Ein zweiter Zahnarzt führte in allen Therapiegruppen eine Prophylaxe-Intervention in Form von professionellen Zahn- und Prothesenreinigungen und Mundhygieneinstruktionen durch. Hilfsmittel zur Mund- und Prothesenhygiene wurden verteilt und erklärt. Die Kontrollgruppe blieb ohne Intervention, Instruktion und Hilfsmittel. Alle Therapiegruppen erhielten eine professionelle Zahn- und Prothesenreinigung, sowie individuelle Instruktion und Motivation. Eine Therapiegruppe verblieb ohne weitere Remotivation, die zweite Therapiegruppe wurde im weiteren Studienverlauf von einem Zahnarzt und die dritte Therapiegruppe von vorab geschultem Pflegepersonal betreut.
Die statistische Auswertung ergab über den Zeitraum von 3 Monaten eine signifikante Verbesserung der Mundhygiene-Indizes aller Therapiegruppen gegenüber der Kontrollgruppe. Zwischen den Therapiegruppen konnte kein Unterschied festgestellt werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Prophylaxekonzepte klinisch erfolgreich waren. Ein personeller Mehraufwand durch Remotivation zeigte über den Studienzeitraum von 3 Monaten keinen zusätzlichen Nutzen.
Zur Verbesserung der inadäquaten klinischen Situation institutionalisierter Senioren kann eine Zahn- bzw. Prothesenreinigung alle 3 Monate empfohlen werden. Durch die Vermeidung intraoraler Entzündungen und die Minimierung intraoraler Plaque durch konsequente Individualprophylaxe ist nicht nur eine Verbesserung des Mundgesundheitszustandes, sondern auch eine Beeinflussung systemischer Erkrankungen und des Allgemeinbefindens der Senioren möglich.
Zweiter Platz: Tutorenprogramm für Grundschulkinder
(Dr. Claus H. Reinhardt [1,2], Nadine Löpker [3], Prof. Dr. Michael J. Noack [2], Dr. Evelyne Rosen [4], Prof. Dr. Klaus Klein [5])
#Reinhardt#Neue Wege geht das Team um Dr. Claus Reinhardt aus Köln, das den zweiten Platz (Dotierung: 3.000 Euro) belegte. Entwickelt wurde ein innovatives, fächerübergreifendes Konzept zur Kariesprävention bei Grundschulkindern mit hohem Migrationsanteil.
Hintergrund: Bei Kindern ist eine starke Ungleichverteilung der Karieshäufigkeit zu beobachten. Mehr als 75% der Karies wird bei Kindern aus sozial benachteiligten Bevölkerungsschichten festgestellt. Gleichzeitig sind die Erfolge zielgerichteter Präventionsanstrengungen gerade bei dieser Bevölkerungsgruppe gering.
Ziele der Studie: Evaluation eines adressatenorientierten Tutorenprogramms hinsichtlich der Steigerung von Mundgesundheit förderndem Verhalten bei Erst- und Viertklässlern in einer sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppe mit hohem Migrationshintergrund.
Studiendesign: Zwei vierte Klassen (30 Kinder, Durchschnittsalter 9,6 Jahre) und zwei erste Klassen (38 Kinder, Durchschnittsalter 6,6 Jahre) wurden zufällig in einer dreizügigen Kölner Grundschule mit hohem Migrationsanteil ausgewählt.
Die vierten Klassen absolvierten einen vorbereitenden Unterricht hinsichtlich der Grundlagen der Kariesentstehung und einer adäquaten Mundhygiene. Mittels dieser Hintergrundinformationen entwickelten die Viertklässler in einem fächerübergreifenden Unterrichtsprojekt ein Tutorenprogramm in dem sie den Erstklässlern das oben genannte Wissen in Theorie und Praxis beibringen könnten. Im Anschluss wurden hinsichtlich der Herkunftsländer möglichst homogene Gruppen aus Erst- und Viertklässlern gebildet und das Tutorenprogramm während zwei Unterrichtsstunden durchgeführt.
In dieser Längsschnittstudie wurde jeder Erst- und Viertklässler vor und sieben Tage nach dem Tutorenprogramm interviewt, sein Zähneputzen aufgezeichnet und hinsichtlich Zahnputzzeit, Zahnputzmethode und –systematik ausgewertet.
Ergebnisse: Nach Durchführung des Tutorenprogramms fanden sich sowohl bei Erst- als auch Viertklässlern signifikant häufiger (P<.001) kreisende Zahnputzbewegungen und eine alle Zahnflächen erfassende Zahnputzsystematik, bei den Viertklässlern fand sich zusätzlich eine signifikant (P<.001) verlängerte Zahnputzzeit.
Schlussfolgerungen: Das vorgestellte Tutorenprogramm führte bei Erst- und Viertklässlern zu signifikanten Verbesserungen der untersuchten Mundhygieneparameter. Durch das Tutoren-Studiendesign konnten den Erstklässlern authentische Rollenmodelle präsentiert werden und so sowohl sprachliche als auch kulturelle Barrieren überwunden werden und gleichzeitig den Viertklässlern eine Lernumgebung angeboten werden, die Empowerment (Selbstwirksamkeit) stärken kann.
Dieses Tutorenprogramm wurde unter Beachtung der gültigen Lehrpläne der Erst- und Viertklässler entwickelt und kann mittels der entwickelten Materialien vom lokalen Lehrkörper weitgehend selbst unter Aufwendung minimaler Zusatzkosten durchgeführt werden. Weiterhin profitieren sowohl die Viertklässler, die als Tutoren fungieren, als auch die Viertklässler, die unterrichtet wurden. Damit scheint dieser Ansatz ein machbarer und anwendbarer Anstoß zur Stärkung der Mundhygiene in Grundschulen allgemein und in Grundschulen mit hohem Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund im Speziellen zu sein. Nächster Schritt wird nun die Evaluation dieses Ansatzes in weiteren Modellgrundschulen sein, um so feststellen zu können, ob dieser Ansatz in der Fläche eingesetzt werden kann.
Adressen Arbeits- / Autorengruppe
Dr. C. Reinhardt, Barthelstr. 36, 50823 Köln, Tel: 0221 / 2718258, drcreinhar@aol.com
1 Studienseminar Köln, Seminar für das Lehramt am Berufskolleg Köln, Claudiusstraße 1, 50678 Köln
2 Medizinische Einrichtungen der Universität zu Köln, Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
– Zahnerhaltung und Parodontologie, Kerpener Str. 32, 50931 Köln
3 Katholische Grundschule, Neufelder Straße 2-4, 51067 Köln
4 Université Charles-de-Gaulle Lille 3, Domaine universitaire du “Pont de Bois“,
BP 149, 59653 Villeneuve d`Ascq cedex, France
5 Forschungsstelle für Gesundheitserziehung des Instituts für Biologie und ihre Didaktik der Universität zu
Köln, Herbert-Lewin-Str. 2, 50931 Köln
Dritter Platz: Säurebildung durch probiotische Laktobazillen
(Reinhard Schilke [1], Florian Gunzer [2], Mariam Khoramnia [1], Maren Koch [1], Ludwig Hoy [3], Angela Beckedorf [1], Imke Wahl [1], Gabriele Leyhausen [1], Joachim Volk [1])
#Schilke#Dritter Platz: Säurebildung durch probiotische Laktobazillen
Der dritte Platz (Dotierung: 2.000 Euro) ging an Dr. Reinhard Schilke, Hannover. Untersucht wurde, ob probiotische Laktobazillen den pH-Wert einer kohlenhydrathaltigen Lösung weniger als kariogene Laktobazillen senken. Das Resultat zeigt, dass bestimmte Kombinationen von Laktobazillen und Kohlenhydraten den pH-Wert genauso deutlich senken können. So gesundheitsfördernd probiotische Laktobazillen in anderer Hinsicht auch sein können, ihr kariogenes Potenzial sollte bei längerem Verbleib in der Mundhöhle daher nicht unterschätzt werden.
Laktobazillen gehören zur physiologischen Standortflora der Mundhöhle. Durch ihre Fähigkeit niedermolekulare Kohlenhydrate zu organischen Säuren zu metabolisieren, ist ihre Rolle in der Kariogenese unbestritten. Einige Laktobazillen werden in Therapeutika und probiotischen Lebensmitteln jedoch zur Förderung der Gesundheit eingesetzt. Die Auswirkung dieser Laktobazillen auf die Mundhöhle wird kontrovers beurteilt. In einer In-vitro-Studie wurde die Änderung des pH-Wertes eines Flüssigmediums durch verschiedene Laktobazillen in Abhängigkeit zu unterschiedlichen Kohlenhydratquellen untersucht. Die Ergebnisse von Typstämmen bekanntermaßen kariogener Laktobazillen werden denen von probiotischen Keimen gegenüber gestellt.
Die Typstämme der vier häufig in der Mundhöhle nachgewiesenen Laktobazillen L. acidophilus, L. casei, L. fermentum und L. salivarius subsp. salivarius sowie die vier handelsüblichen probiotischen Laktobazillen-Stämme L. acidophilus La 5, L. paracasei subsp. paracasei, L. reuteri protectis und L. rhamnosus GG wurden jeweils in einem modifizierten MRS-Medium in einer Ausgangskonzentration von 1 x 107 lebenden Keimen pro ml Lösung bei 37 °C und 5 % CO2 inkubiert. Als Kohlenhydratquelle wurden diesem Medium äquimolare Zusätze der Monosaccharide Fruktose oder Glukose (20 g × l-1) bzw. halb-äquimolare Mengen der Disaccharide Laktose und Saccharose zugesetzt. Der Ausgangs-pH wurde auf 5,7 eingestellt. Der pH-Wert wurde nach 4, 8, 12 und 24 Stunden aufgezeichnet. Die pH-Werte nach 24 Stunden wurden mittels der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit paarweisem Gruppenvergleich nach Scheffé auf Signifikanz untersucht.
Das Wachstumsverhalten der Laktobazillen differierte in Abhängigkeit vom Kohlenhydratangebot. Bei fünf Keimen wurde innerhalb von 8 Stunden mit allen vier Zuckern der für Zahnschmelz als kritisch angesehene pH-Wert von 5,2 bereits deutlich unterschritten. Der Typstamm L. casei sowie die beiden probiotischen Stämme L. paracasei subsp. paracasei und L. rhamnosus GG in Kombination mit Laktose und Saccharose zeigten innerhalb dieses Zeitraums nur eine moderate pH-Werterniedrigung. Während sich der pH bei den beiden probiotischen Keimen im weiteren Verlauf nur geringfügig änderte, fiel er bei L. casei in der laktosehaltigen Lösung bis auf 3,8 ab. Nach 24 Stunden lag der pH-Wert in den Lösungen mit Fruktose zwischen 4,5 und 3,2, mit Glukose zwischen 3,9 und 3,3 mit Laktose zwischen 5,6 und 3,5 und mit Saccharose zwischen 5,3 und 3,2. Der Typstamm L. salivarius subsp. salivarius konnte den pH aller Zuckerlösungen bereits nach 4 Stunden am deutlichsten erniedrigen. Jedoch wurden auch bei allen probiotischen Keimen signifikante pH-Wertsenkungen gemessen.
Alle untersuchten Laktobazillenspezies können den pH-Wert in den monosaccharidhaltigen Nährmedien in einen kariesrelevanten Bereich erniedrigen. Lediglich bei bestimmten Kombinationen eines probiotischen Keimes und eines Disaccharids zeigte sich eine geringere pH-Wertsenkung. Bei einer Retention probiotischer Laktobazillen in der Mundhöhle muss daher neben einer gesundheitsfördernden Interaktion mit Wirtszellen oder anderen Bakterien auch deren kariogenes Potenzial beachtet werden.
Adressen Arbeits- / Autorengruppe
1 Medizinische Hochschule Hannover, Zentrum Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Klinik für Zahnerhaltung,
Parodontologie und Präventive Zahnheilkunde (Direktor: Prof. Dr. W. Geurtsen), Carl-Neuberg-Str. 1,
30625 Hannover, E-Mail: schilke.reinhard@mh-hannover.de
2 Technische Universität Dresden, Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus, Institut für Medizinische
Mikrobiologie und Hygiene (Direktor: Prof. Dr. E. Jacobs), Fetscherstr. 74, 01307 Dresden
3 Medizinische Hochschule Hannover, Zentrum Biometrie, Medizinische Informatik und Medizintechnik,
Institut für Biometrie (Direktor: Prof. Dr. A. Koch), Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover
Sonderpreis: Mundgesundheitsförderung bei Menschen mit Behinderungen
(Dr. Imke Kaschke)
#Kaschke#Einen Sonderpreis (Dotierung: 1.000 Euro) vergab die Jury an Dr. Imke Kaschke, Berlin, für ihre förderungswürdige Initiative zur Verbesserung der Mundgesundheitssituation von Menschen mit Behinderungen.
Der Erhalt der Zahn- und Mundgesundheit durch zahnmedizinische Prophylaxemaßnahmen ist eine wichtige Aufgabe für Menschen mit Behinderungen und ihre Betreuer. Bisherige Studien haben gezeigt, dass bei den in Wohneinrichtungen lebenden Menschen mit Behinderungen die Mund- und Mundhygiene erhebliche Mängel aufweist. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Ein wesentlicher Faktor neben dem Zeitmangel des Personals scheint hierbei das fehlende Wissen um die Wichtigkeit der Zahn- und Mundhygiene für den allgemeinen Gesundheitszustand und die nur unzureichende Instruktion der Bewohner selbst entsprechend ihrer Kooperativität sowie auch der Betreuer in der Durchführung der Zahnpflege.
Ziel der vorliegenden Untersuchung war deshalb die Bewertung eines Modells zur Mundgesundheitsförderung für erwachsene Bewohner Berliner Behinderten-Einrichtungen. Es wurde beurteilt, inwieweit durch gezielte Schulung und praktische Fortbildung des Betreuungspersonals in Zusammenarbeit mit den Bewohnern die Durchführung der Zahn- und Mundhygienemaßnahmen verbessert werden konnte.
Hierzu wurden aus 31 Wohnbereichen für Menschen mit Behinderungen in Berlin im Rahmen eines Gruppenprophylaxeprojektes 193 Probanden, von denen 95 Probanden zu einer Wartekontrollgruppe und 98 zur Interventionsgruppe gehörten, in die Untersuchung einbezogen.
Nach der Datenerhebung zur Mundhygienesituation auf einem speziell entwickelten Datenblatt in beiden Gruppen, erfolgten in der Interventionsgruppe die theoretische Fortbildung mittels standardisiertem Power Point Vortrag sowie praktischen Zahn- und Mundpflegeübungen für die Bewohner mit ihren Betreuern unter Anleitung von zwei Prophylaxeteams. Vier Wochen nach der Erstbefragung wurden die Daten zur Mundhygienesituation in beiden Gruppen erneut erhoben.
Die Daten wurden mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS 13.0 für Windows ausgewertet. Zur Analyse der Häufigkeitsverteilungen wurde der Chi- Quadrat- Test angewendet. Zum Vergleich von Werten zwischen den Gruppen wurde der Mann-Whitney-U-Test genutzt. Der Vergleich der Vorher- und Nachhermessungen innerhalb der jeweiligen Gruppe erfolgte mittels des Wilcoxon-Tests.
Beim Vergleich der Daten zum zweiten Befragungstermin zwischen Wartekontroll- und Interventionsgruppe zeigte sich, dass in der Interventionsgruppe umfangreiche Veränderungen in der Durchführung der Zahn- und Mundhygiene erreicht werden konnten. So verwendeten nahezu die Hälfte (49 %) dieser Probanden zum zweiten Befragungstermin eine behindertengerechte Zahnbürste (zum Untersuchungsbeginn nur 6%) und fast zwei Drittel (70%) von ihnen eine für Behinderte empfohlene Zahnpasta (zum Untersuchungsbeginn nur 6%). Eine regelmäßige Fluoridanwendung erfolgte für 68,4% der Probanden dieser Gruppe (zum Untersuchungsbeginn nur 4%). Die Zahnpflege nach dem Essen am Morgen war nun für 78,6 % dieser Bewohner garantiert (zum Untersuchungsbeginn nur für 28% dieser Probanden) und fast alle Teilnehmer dieser Gruppe putzten ihre Zähne 1 bis 2 Minuten oder länger (zum Untersuchungsbeginn nur 55%). Nach der Intervention waren noch 41 % der Probanden Selbstputzer (zum Untersuchungsbeginn 78%), aber 45 % erhielten nun Hilfe bei der täglichen Durchführung der Mundhygiene durch einen Betreuer (Mit-Hilfe-Putzer, anfänglich nur 7%). Für 14 % erfolgte die Zahnreinigung ausschließlich durch eine Betreuungsperson.
Als Schlussfolgerung für die Praxis ergeben sich aus den vorliegenden Ergebnissen sowohl die Forderung nach individuell abgestimmten Mundhygienemaßnahmen für Bewohner von Behinderteneinrichtungen als auch nach entsprechenden Fortbildungsangeboten für Fachpersonal zur Zahn- und Mundgesundheit. Darüber hinaus sollten spezifisch zu entwickelnde Prophylaxeprogramme für Menschen mit Behinderungen über alle Lebensaltersgruppen entwickelt werden. Nur so kann für Menschen mit Behinderungen eine der Restbevölkerung entsprechende Mundgesundheit erreicht werden. Mit dem vorgestellten Gruppenprophylaxeprogramm konnte das Mundhygieneverhalten von Bewohnern und deren Betreuern in Berliner Behindertenwohneinrichtungen verbessert werden. Unabdingbare Vorraussetzung für den Erhalt des erreichten Niveaus der Mundgesundheit sind neben regelmäßigen Folgeunterweisungen vor allem die langfristige Sicherstellung der Finanzierung dieser Maßnahmen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe im Sinne der Daseinsfürsorge für Mitmenschen mit Behinderungen.
Adresse Autorin
Arbeitskreis Zahnmedizinische Betreuung von Patienten mit Behinderungen der ZÄK Berlin
Dr. Imke Kaschke, Leiterin des Arbeitskreises, Stallstr. 1, 10585 Berlin, E-Mail: imke_kaschke@web.de