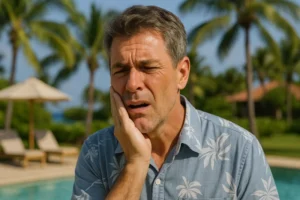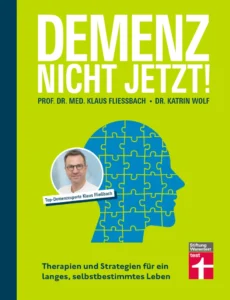1984 bis 2009 – 25 Jahre Prophylaxe – Viel erreicht und nichts gewonnen?
Machen wir einmal eine Zeitreise: 1984, da war die Karies ein alltägliches Problem in Deutschland; praktisch jeder Erwachsene hatte zahlreiche Defekte, und deren Therapie (sofern man im modernen Sinne überhaupt von einer Therapie sprechen konnte) verschlang Unsummen. Während in unseren Nachbarstaaten Schweiz und den skandinavischen Ländern bereits große Fortschritte in der Prävention gemacht worden waren, hinkte Deutschland da noch gewaltig hinterher. Dabei konnte man ein Ost-West-Gefälle nicht übersehen. Während in der damaligen DDR durch die TWF (Trinkwasserfluoridierung) zumindest in einigen Gebieten die Zahngesundheit der Bevölkerung gebessert werden konnte, lief im Westen alles (noch) seinen gewohnten Gang. Die GKV zahlte für alle Schäden zu 100 Prozent, und die Ausgaben stiegen mit zweistelligen Zuwachsraten weiter.
Verschärft worden war die Situation durch das „Prothetikurteil“ von 1972, demzufolge jeder in einer gesetzlichen Kasse Versicherte vollen Anspruch auch auf hochwertige Prothetik hatte, gleich, was immer das auch an Kosten auslösen mochte.
Da gab es dann so absurde Situationen, wie die, dass sich Asylanten und Gastarbeiter hier für viel Geld (das die Beitragszahler aufzubringen hatten) „vergolden“ ließen, um dann zuhause in ihren Herkunftsländern den teuren Zahnersatz nur des Gegenwertes des Goldes wegen (!) diesen wieder entfernen zu lassen, um anschließend wieder in Deutschland neuen (!) Zahnersatz zu beantragen, usw.
Dies musste zwangsläufig in einer Katastrophe enden, das war allen Beteiligten wohl klar. Nur, wie das ändern?
1986 reagierte der Gesetzgeber mit harten Einschnitten – die Honorare der Zahnärzte wurden teilweise massiv abgesenkt, die Leistungsversprechen für den Bereich Zahnersatz wurden leicht zurückgenommen, und es wurden Selbstbeteiligungsregelungen in der GKV eingeführt. Parallel dazu wurde der Begriff der „Prophylaxe“ neu in die Sozialgesetzgebung aufgenommen, und es wurden Leistungen dafür beschrieben. Und in den Folgejahren – mit jeder „Reform“ – wurden weitere Einschnitte vorgenommen, bis 1993 dann mit dem Minister Seehofer ein besonders brutaler Kurswechsel erfolgte. Den Zahnärzten, bis dahin als „Spitzenverdiener“ angesehen (damals mit einem gewissen Recht, wobei immer übersehen wurde, dass da eine irre Arbeit dahinter steckte, mit Arbeitszeiten von 80 und mehr Wochenstunden), wurde als „Ärztepack“ (O-Tom Seehofer) das Kreuz gebrochen, der Widerstand lief ins Leere (wer erinnert sich noch an „Korb“?) angesehen und durch Eingriffe in die Selbstverwaltung (Stichwort „Staatskommissar“) wurde die Zahnärzteschaft mundtot gemacht.
Aber: immerhin, die Prophylaxe fand Eingang in die GKV. Und: Sie begann überraschend schnell Wirkung, zu zeigen.
Besonders bei Kindern ging die Zahnerkrankung durch Karies signifikant zurück. Inzwischen ist bei den Kindern mit Karies Deutschland auch international spitze. Bei den 12 jährigen sind 0,7 Zähne mit Karies befallen, gefüllt oder nicht vorhanden (DMFT 0,7). Auch bei Erwachsenen hat die Karies an Bedeutung verloren.
Die Gesamtkosten für Zahnbehandlung sind jedoch nicht kleiner geworden. Weshalb? Jeder Fachkundige konnte schon von Beginn der Prophylaxebemühungen ein solches Ergebnis vorhersagen – war für ein Großteil der Bevölkerung 1984 noch im relativ jungen Alter von 50 die Prothese Endstation der Zahnheilkunde, finden wir heute auch 90jährige mit eigenen Zähnen vor. Der Behandlungsbedarf wurde also nicht durch die Prävention ersetzt, sondern lediglich in ein höheres Lebensalter verschoben. Zusätzlich tauchte ein neues Problem auf: gingen vor 26 Jahren die Zähne hauptsächlich durch Karies verloren, so sehen wir heute eine ernste Bedrohung durch die Parodontitis, die Erkrankung des Zahnhalteapparats, wie aktuell die vierte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS IV) zeigt. Das Institut für Deutsche Zahnärzte hatte im Auftrag der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) und der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) eine Stichprobe von 4.641 Patienten ausgewertet. Das Resultat: Die Deutschen leiden mehr und mehr an Erkrankungen des Zahnfleisches und der Kieferknochen. Etwa jeder dritte Deutsche hat demnach einen dringenden Therapiebedarf, ein weiteres Drittel ist milder parodontal erkrankt, und gingivitisfrei ist praktisch kaum jemand.
Aber: die DMS IV hat auch gezeigt, dass Prophylaxe Wirkung zeigt – wir sehen eine kontinuierliche Verbesserung seit der DMS I, und dies soll an einem Zwischenbericht demonstriert werden. Der Gesundheitssurvey der BRD (erhoben vom RKI) zeigte noch 1998 folgendes Bild:
(Kap. 5.21 Karies und Parodontopathien) „Zahnkaries und entzündliche Erkrankungen des Zahnhalteapparates (Parodontopathien) sind die häufigsten Erkrankungen der Zähne. In Deutschland sind mehr als 99% der Erwachsenen von einer der beiden Erkrankungen betroffen“.
Weiter: „Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Zahnerkrankungen ist erheblich. Allein die gesetzlichen Krankenkassen gaben im Jahr 1995 für Zahnersatz und zahnärztliche Behandlung 21,2 Mrd. DM aus; dies entspricht etwa 10% ihrer gesamten Leistungsausgaben. Sie werden überwiegend für reparative Maßnahmen aufgewendet. Die Zahngesundheit lässt sich durch Mundhygiene und Ernährung wirksam beeinflussen. Karies und Parodontopathien können deshalb durch entsprechendes Verhalten bzw. geeignete Maßnahmen weitgehend vermieden werden“.
Risikofaktoren
Drei Komponenten beeinflussen entscheidend die Entstehung von Karies und Parodontopathien:
- Menge und Art der in der Plaque enthaltenen Mikroorganismen
- die Beschaffenheit der Zahnhartsubstanzen, die Speichelzusammensetzung sowie die Immunlage (individuelle Faktoren) und
- die Häufigkeit der Zuckeraufnahme sowie die Anwendung von Fluoridpräparaten (Ernährungs- und Zahnpflegegewohnheiten).
Erbliche Faktoren spielen bei der Entstehung von Zahnkaries und Parodontopathien nur eine untergeordnete Rolle. Einen erheblichen Einfluss haben dagegen soziale Aspekte und damit verbundene Ernährungs- und Mundhygienegewohnheiten, so das RKI.
|
|
Tab. Risikofaktoren für Karies und Parodontopathien |
|
||
|
|
Risikofaktoren |
Folgen |
|
|
|
|
Karies |
Parodonto- |
|
|
|
|
Ernährung |
|
|
|
|
|
• Zuckergehalt |
++ |
+ |
|
|
|
• Häufigkeit der Mahlzeiten |
+++ |
+ |
|
|
|
• Gehalt freier Säuren |
+ |
– |
|
|
|
Mundhygiene |
|
|
|
|
|
• unzureichende Zahnpflege |
++ |
++++ |
|
|
|
• fluoridfreie Zahncreme |
+++ |
– |
|
|
|
Zahnstatus |
|
|
|
|
|
• Engstand |
++ |
++ |
|
|
|
• überstehende Füllungen, Kronen |
+++ |
++ |
|
|
|
• Zahnstein |
– |
+++ |
|
|
|
Speichelsekretion |
|
|
|
|
|
• reduzierte Menge |
++++ |
++ |
|
|
|
• reduzierte Pufferung |
++++ |
– |
|
|
|
Mikroorganismen |
|
|
|
|
|
• Plaquemenge |
+++ |
+++ |
|
|
|
• Plaquezusammensetzung |
|
|
|
|
|
– säureunempfindliche Mikroorganismen |
++++ |
– |
|
|
|
– gramnegative bewegliche Mikroorganismen |
– |
++++ |
|
|
|
Indirekte Risikofaktoren |
|
|
|
|
|
• Streß, chronische Erkrankungen |
++ |
++ |
|
|
|
• Schichtarbeit |
++ |
++ |
|
|
|
• Dauereinnahme bestimmter Medikamente |
++ |
++ |
|
|
|
Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an König. |
|
||
Epidemiologie
Für die statistische Erfassung der Karies wird üblicherweise der DMF-T- bzw. DMF-S-Index verwendet, bei dem die kariösen (decayed), fehlenden (missing) und gefüllten (filled) Zähne (teeth) bzw. Zahnflächen (surfaces) addiert werden. Für das Milchgebiss wird der entsprechende DMF-T- bzw. DMF-S-Index verwendet. Der so gezählte Kariesbefall eines Menschen summiert sich im Laufe des Lebens (lifetime caries experience).
Seit 1986 geht die Erkrankungsrate (Karies) deutlich zurück (Tabelle: Daten von IDZ 1989 im Westen und im Jahr 1992 im Osten. Die Zahl der kariösen, gefüllten oder wegen Karies fehlenden Zähne betrug bei den 13 bis 14 jährigen im Westen 5,1 und im Osten 4,3, bei den 35 bis 54 jährigen 17,5 bzw. 14,5. Für Schulkinder im Alter von 6 bis 7, 9 bzw. 12 Jahren wurden 1994 im Auftrag der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege (DAJ) repräsentative Daten erhoben, die ebenfalls in der Tabelle dargestellt sind.
|
|
Tab. Zahngesundheit |
|
||||
|
|
Alter |
Mittlere Zahl betroffener Zähne |
|
|||
|
|
insgesamt |
kariös |
fehlend |
gefüllt |
|
|
|
|
DMF-T |
D-T |
M-T |
F-T |
|
|
|
|
|
Westen |
|
|||
|
|
8 bis 9 |
1,50 |
0,84 |
0,02 |
0,66 |
|
|
|
13 bis 14 |
5,10 |
2,14 |
0,05 |
2,95 |
|
|
|
35 bis 54 |
17,50 |
1,86 |
5,40 |
10,27 |
|
|
|
|
Osten |
|
|||
|
|
8 bis 9 |
1,10 |
0,20 |
0,00 |
0,80 |
|
|
|
13 bis 14 |
4,30 |
0,70 |
0,10 |
3,50 |
|
|
|
35 bis 54 |
14,50 |
0,90 |
6,40 |
7,20 |
|
|
|
|
Deutschland |
|
|||
|
|
6 bis 7 |
0,18 |
0,11 |
0,00 |
0,08 |
|
|
|
9 |
0,95 |
0,29 |
0,01 |
0,67 |
|
|
|
12 |
2,43 |
0,50 |
0,04 |
1,89 |
|
|
|
Quelle: IDZ-Surveys 1989, 1992; DAJ-Studie 1994. |
|
||||
Im Vergleich der Ergebnisse der 1973 von der WHO durchgeführten International Collaborative Study of Dental Manpower Systems (ICS I) ist Karies bei Kindern und Jugendlichen deutlich zurückgegangen. Damals war bei 8 bis 9jährigen in Deutschland noch ein mittlerer DMF-T-Wert von 3,3 festgestellt worden.
Wir haben aktuell zwei Problemfelder; eines ist die nach wie vor viel zu hohe Parodontitismorbidität – hier sind analog der Kariesprophylaxe Präventionsmaßnahmen einzuführen – und die Problematik der schichtspezifischen Erkrankungsrate, die schon früh erkannt wurde. Dazu das RKI 198 (der aktuelle Gesundheitssurvey der BRD aus 2007 hat dies nochmals besonders deutlich bestätigt):
„Die Zahnkaries ist in Deutschland wie in vergleichbaren Industrieländern ungleich verteilt. Die Hauptlast der beobachteten Karies konzentriert sich auf eine verhältnismäßig kleine Personengruppe. 1989 entfielen bspw. im Westen 71% aller DMF-Zähne der 8 bis 9jährigen auf nur 28% der Kinder dieser Altersgruppe. Diese Erkenntnis hat eine erhebliche präventions- bzw. versorgungspolitische Bedeutung, da vor allem Kinder und Jugendliche der unteren Sozialschichten überproportional von dieser Karieskonzentration betroffen sind“.
|
|
Abb. Kariesbefall und soziale Schicht im Westen 1989 |
|
|
|
|
|
|
|
Quelle: IDZ-Survey 1989. |
|
|
|
Abb. Parodontitis bei 35 bis 54jährigen |
|
|
|
|
|
|
|
Quelle: IDZ-Surveys 1989, 1992. Der Schweregrad ist im Abschnitt "Verbreitung" unter "Parodontopathien" erläutert. |
|
Wenden wir uns nun der aktuellen Situation zu:
Die Ergebnisse der DMS IV-PI (parodontale Frühuntersuchung): „Die Prävalenzen der 12Jährigen, 15Jährigen und 35-44Jährigen lagen für die Grade 0 bis 1 bei ca. 30-37%, Grade 2 + 3 bei ca. 63-70%; der Senioren bei ca. 20 bzw. 80%. PBI: 12- und 15Jährige mit ca. 75% Prävalenz der Grade 0–2, ca. 25% der Grade 3 + 4; Erwachsene mit ca. 66 bzw. 34%, Senioren mit ca. 43 bzw. 57%.
Der deutliche Anstieg der Parodontitisprävalenz im Vergleich zur DMS III (1997) sowohl bei den Erwachsenen (Grad 3 um 20,5 und Grad 4 um 6,4 Prozentpunkte) als auch bei den Senioren (Grad 3 um 8,3 und Grad 4 um 15,4 Prozentpunkte) lässt die aktuellen Präventions- und Therapiekonzepte kritisch hinterfragen“.
Zusätzlich ist sehr kritisch zu sehen, dass die Divergenz der Gesellschaft bezüglich Gesundheit weiter zunimmt – vereinfacht ausgedrückt: Die Prävention kommt bei Angehörigen der Unterschicht nicht im gewünschten Maße an.
Beides, die nach wie vor unbefriedigende Situation bezüglich parodontaler Gesundheit sowie die auch bezüglich Karies auffällige Morbidität bei Angehörigen der sozialen Unterschicht kann trotz aller bisherigen Erfolge der Prophylaxe in Deutschland nicht befriedigen – wir haben viel erreicht, aber, es ist ebenso noch sehr viel zu tun!
Für Interessierte: Inhalte werden bei www.dentalkolleg.de vertiefend als DVD-Fortbildung angeboten (mit Fortbildungspunktevergabe), ebenso lernen Sie dort Wege zur besseren Umsetzung der Prävention. Ein QM-System, das die Erkenntnisse der DMS IV-Studie (PAR, schichtspezifische Morbidität) in wirksame Praxisabläufe umsetzt, erhalten Sie unter www.gh-praxismanager.de.
gh