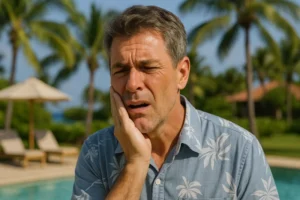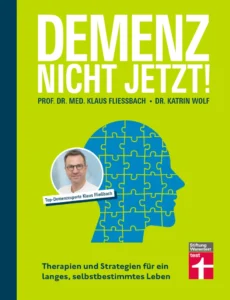Der Schmerzpatient
Kaum ein Ereignis ist für den Ablauf einer Bestellpraxis störender als der Schmerzpatient. Dieser will aus verständlichen Gründen eine sofortige Hilfe einfordern – andererseits pocht der einbestellte Patient naturgemäß darauf, seinen lange im Voraus vereinbarten Termin wahrzunehmen. Für die Praxis ergibt sich daraus eine unangenehme Konfliktsituation – meist ist es unmöglich bedient Ansprüchen gleichzeitig gerecht zu werden.
Die häufigste Ursache für eine unangemeldete Visite beim Zahnarzt als „Schmerzpatient“ ist der pulpitische Schmerz, gefolgt von der Parodontitis apicalis.
Beide Krankheitsbilder erfordern unmittelbares Handeln, da sie von kaum erträglichen Schmerzen für die betroffenen Patienten begleitet werden. Gleichzeitig steht dafür in der normalen Bestellpraxis nur wenig Zeit zur Verfügung. Um diese Situation einigermaßen zu handeln gibt es erprobte Vprgehensweisen, die auch in der Wissenschaft, wenn auch mit Vorbehalten, anerkannt sind und die eine echte Praxisrelevanz haben. Studien, u.a. in der Schweiz (Barbakov et al) oder Deutschland (Briseno et al) haben gezeigt, dass gut zwei Drittel aller Praktiker sich dazu des Präparates „Ledrmix“ bedienen, dessen Potenzial zur raschen Schmerzausschaltung trotz der in Deutschland vorherrschenden Aversion gegen Kombipräparate zur Zulassung durch die Behörde geführt hat.
Die Behandlung der beiden häufigsten Schmerzbilder im Einzelnen:
Pulpitisschmerz
Pulpitische Schmerzen können durch chemische Noxen oder mechanische Traumata verursacht sein. Typisch ist z.B. der Schmerzpatient, der nach Eingliederung von Zahnersatz oder einer Füllungsversorgung mit postoperativen Beschwerden vorstellig wird. Hier kann es sich um Aufbissempfindlichkeiten (Füllung bzw. Krone „zu hoch“), um Störung der Laterotrusion 8insbesondere bei Hyperbalancen) oder ähnliche Phänomene gehen. Die Abhilfe ist: einschleifen, wobei man darauf achten muss, dass z.B. Okklusionsstörungen mit Balancen durch ein Niederschleifen nur temporär zu bessern sind, durch herauswaschsen aus der Alveole die Sensibilitäten später dann noch verstärkt auftreten. Die Überprüfung mit Shimstockfolie (Okklusionspapier ist zu dick und deshalb ungenau) sollte eine korrekte Okklusion bei Lateralbewegung sicherstellen.
„Füllung zu hoch“ ist kein seltener Befund, da meist eine Füllung unter Lokalanästhesie gelegt wird und der Patient beim „Zubeißen“ gar nicht beurteilen kann, ob die Füllung korrekt in der Höhe ist oder nicht. Hier ist differentialdiagnostisch genau zu unterscheiden, um welche Form der Störung es sich handelt, da die Maßnahmen zur Korrektur teilweise diametral anders sind.
Postoperativer Schmerz kann aber auch aus einer pulpitischen Reaktion auf Grund es Zementiervorgangs bei ZE oder auf Grund des Füllungsmaterials herrühren. Die Unterscheidung, ob die Pulpitis durch mechanische oder chemische Noxen ausgelöst wurde, ist im Einzelfall häufig unmöglich. Hier gilt, erst die wahrscheinlichste Ursache abzustellen und bei weiteren Beschwerden den anderen möglichen Ursachen nachzugehen.
Be4dauerlicherweise können pulpitische Beschwerden, wenn sie erst einmal manifest geworden sind, länger persistieren, auch wenn die Ursache objektiv abgestellt wurde. So kann das mechanische Trauma eine lang andauernde Pulpitis auslösen, die auch bei Beseitigung der Störung anhält.
Die Abnahme einer Krone ist nun ebenso problematisch wie die erneute Füllungstherapie, da zusätzlich zur bereits bestehenden Pulpitis noch das erneute Schleiftrauma kommt. Und hier scheiden sich die Wege:
Nicht selten wird eine Vitalexstirpation der Pulpa vorgenommen, mit der Folge der endodontischen Behandlung. Dies weist Nachteile auf – zuförderst gerät der Zahnarzt durch eine solche Vorgehensweise in noch mehr Zeitnot (Anästhesie, Trepanation, Vitalexstirpation, prov. Verschluss – eine korrekte Aufbereitung und Abfüllung der Wurzelkanäle ist aus Zeitgründen in den seltensten Fällen unmittelbar möglich), und dann besteht ja auch noch die Problematik, dass nun ein vitaler Zahn definitiv devital ist, mit allen weiteren folgen.
Hier wird als praxistaugliche Alternative folgendes Vorgehen empfohlen:
Ist eine Pulpitis festzustellen, wird nur kleinflächig durch Krone oder Füllung bis zum Dentin durch die Restauration gefräst und die freigelegte Dentinfläche mit Ledermix Paste benetzt, daraufhin die Bohrung mit einem Wattepellet und einer stabilen Abdeckung (Zement) versorgt. Die Eröffnung sollte wirklich kleinflächig erfolgen, das erleichtert später die definitive Versorgung, z.B. durch ein Einlageinlay oder eine Füllung in der Füllung, beides wenig belastende und auch den Geldbeutel des Patienten schonende Vorgehensweisen.
Nach Untersuchungen von Briseno /Mainz kann man davon ausgehen, dass in mindestens 50 Prozent von Zähnen mit einer cp-Behandlung mit Ledermix Paste nach einem Jahr noch Vitalität des Zahns gegeben ist, wobei die Schmerzfreiehit innerhalb ganz kurzer Zeit eintritt. Damit kann man die Vitalexstirpation vermeiden, kann immerhin die Hälfte der Zähne vital erhalten, und man erspart sich enorm viel Stress da die vorsgeschlagene Vorgehensweise nur wenig Zeit erfordert.
Ein heute weniger häufig auftretendes Schmerzbild ist die Pulpitis auf Grund von Karies – trotz verbesserter Prophylaxe und damit verbundener besserer Früherkennung ist dies, je nach Patientengut, trotzdem ein nicht unerhebliches Problem für den Praxisablauf.
Diese Patienten bedürfen einer ebenfalls besonderen Therapie – die röntgenologische Diagnostik kann eine Pulpitis nicht definieren, apikale Veränderungen geben die Nekrose wieder – nur, was sich aktuell in der Pulpa abspielt, das kann kein Röntgenbild zeigen. Wir haben hilfsweise Diagnostikschemata entwickelt: da wird unterschieden zwischen Heißschmerz und Kaltschmerz, Dauer des Reizschmerzes, usw. Sicher sind solche Kriterien nicht. Es kann eine reversible Pulpitis vorliegen oder ein irreversible, die Differenzierung ist unmöglich. Wir können nur die Nähe des kariösen Prozesses zur Pulpa abschätzen.
Beim Excavieren entsteht ein zusätzliches Trauma, das Schleiftrauma. Studien zeigen, dass selbst bei sehr guter Kühlung der Fräs- bzw. Bohrinstrumente eine deutliche Erwärmung im Pulpacavum stattfindet, zusätzlich werden beim arbeiten im Dentin Dentritenfortsätze nicht nur zerschnitten (was eine Verletzung darstellt) sondern auch teilweise herausgerissen.
Insbesondere in Pulpanähe sind die Dentinkanälchen sehr großvolumig, was die Sache nicht erleichtert. Durch diese Kanäle gelangen Bakterien aus infiziertem Material problemlos in die weitgehend schutzlose Pulpa. Die typische Pulpareaktion entspricht der aller Weichgewebe: Entzündung führt zu Schwellung. Nun ist die Pulpa ja gefangen in Hartgewebe und kann nicht anschwellen – das entstehende Ödem wird also lediglich den intrapulpalen Druck erhöhen. Dies führt, der besonderen Anatomie des Apex wegen, zu einer noch schlechteren Blutversorgung, ein Teufelskreis, dem die Pulpa nicht selten zum Opfer fällt – der Zahn wird avital.
Die zahnärztliche Therapie sollte demgemäß darauf gerichtet sein, die Situation der Pulpa zu verbessern: antiödematöse Maßnahmen, zusammen mit wirksamer Keimkontrolle sowie ein Vermeiden eines übermäßigen Schleiftraumas sind Teil einer minimal invasiven Therapie, wie sie allgemein in der Medizin geforert wird.
Hier geben wissenschaftliche Untersuchungen den Weg vor: Wicht, Noack et al (Universität Köln) haben gezeigt, dass z.B. Ledermix eine so hohe keimreduzierende Wirkung hat, dass man auf das übliche vollständige Entfernen allen infizierten Dentins verzichten kann (bedenken wir: Dentin ist auch über die erweichten Anteile hinaus bakteriell belastet, und bei einer akzidentiellen Eröffnung der Pulpa werden Keime in großer Menge in die Pulpa gedrückt.
Schroeder (Basel) sowie Abbot(Sydney) haben zeigen können, dass die lokale Anwendung eines Corticoids mit seiner unmittelbaren antiödematösen Wirkung den intrapulpalen Druck rasch reduziert, was in diesem Fall die Durchblutung fördert und so der Pulpa nützt. Die begleitende Applikation eines stark wirkenden Antibiotikums ist jedoch erforderlich, um die herabgesetzte Immunabwehr zu kompensieren. Lokal applizierte Antibiotika sind in ihrer Wirkung nicht vergleichbar mit systemisch verabreichten – die Konzentration liegt um mehrere Zehnerpotenzen über dem maximal im Serum erreichbaren, so dass z.B. bakteriostatisch wirkende Antibiotika eine bakterizide Wirkung bekommen, wie wir das auch aus der Parodontologie mit lokal applizierten Medikationen kennen.
Im Fall der pulpanahen Kareies empfiehlt sich deshalb ebenfalls die Anwendung von Ledermix, als Paste oder in Form des Ledermix Zement. Praktisch wird dies so umgesetzt, dass in der Tiefe der Kavität jedenfalls noch ein Barriere aus Dentin über der Pulpa erhalten wird, Ledermix punktuell aufgetragen und dann stabil temporär verschlossen wird.
Eine regelmäßige Vitalitätsprüfung ist unbedingt zu empfehlen, um einen stillen Pulpauntergang rechtzeitig zu erkennen.
Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass hier die Vorgaben eines minimal invasiven Therapiekonzepts präzise umgesetzt werden und in mindestes 50 Prozent eine Pulpavitalität dauerhaft erhalten werden kann.
Zeigt sich die Pulpa nach 6 bis 12 Monaten noch vital wird die temporäre Füllung revidiert und der Zahn wie gewohnt mit einer Überkappung mit Calziumhydroxid bzw. einer Versiegelung mit dem Laser und/oder einem dichten Dentinbonding mit antibakterieller Potenz als Layer verschlossen und dien permanente Füllung oder falls erforderlich eine Überkronung durchgeführt.
Stell man im Recall eine devitale Pulpa fest, so ist der Zahn einer endodontischen Therapie zuzuführen.
Devitaler Zahn
Liegt ein devitaler Zahn vor, mit oder ohne röntgenologisch erkennbare apikale Beteiligung, so ist die endodontische Therapie angezeigt. Schmerzen können auch dann auftreten, wenn keine apikale Aufhellung im Röntgenbild dargestellt ist – Ehrmann (Melbourne) gibt an, dass die in etwa 10 Prozent aller Fälle gegeben ist und führt dies auf einen Infekt des Wurzelzeichens zurück, das Phänomen wird von ihm als „Perizementitis“ bezeichnet.
Auch hier erwartet der Patient eine rasche Erleichterung. Die Wurzelbehandlung ist jedoch kaum in so kurzer Zeit machbar, dass das Zeitmanagement der Praxis nicht dadurch empfindlich gestört würde. Die Lokalanästhesie hilft nur kurzzeitig, es ist eine Initialtherapie nötig.
Praxisgerecht ist hier, das Pulpakabum zu eröffnen (also die Trepanation) und eine unmittelbare medikamentöse Einlage vorzunehmen. Diese kann nach initialer Aufbereitung der Wurzelkanäle – falls in der Kürze der Zeit möglich oder falls ausreichend Zeit zur Verfügung steht -, oder sogar ohne den Einsaht von Wurzelkanalinstrumenten erfolgen. Auch hier wird wegen der straken antibakteriellen und antiödemtösen Wirkung der Einsatz von Ledermix als sinnvoll angesehen. Bringt man Ledermix Paste in die Wurzelkanäle ein, so spürt der Patient eine sehr rasche Wirkung, erfahrungsgemäß ist die Schmerzsymptomatik innerhalb weniger Stunden endgültig ausgeschaltet, und bis zum Wirkungseintritt hilft die Anästhesie.
Danach kann man in Ruhe eine Endo-Therapie planen und durchführen.
Liegt eine akute apikale Problematik vor, so leidet der Patient an besonders starken Schmerzen. Gier ist es unvermeidlich, eine Initiale Aufbereitung der Wurzelknolle vorzunehmen und dann Ledermix Paste in die Kanäle einzubringen. Der Methode, einen Zahn nach Eröffnung offen zu lassen, um einen Abfluss eitriger Sekrete zu ermöglichen, wird hier entgegengehalten, dass es dabei zu einer noch massiveren Infektion des apikalen Knochens sowie der Wurzelkanäle kommt mit der Folge, dass die spätere Endotherapie weniger erfolgreich und vor allem zeitaufwendiger wird. Das Einbringen von Ledermix Paste auch in Zähne, die bei der Trepanation eitriges Sekret unter Druck abgeben – jeder Zahnarzt kennt das, dass dabei wie bei einer Quelle Sekret aus dem eröffneten Zahn hervortritt – empfohlen, da innerhalb kürzester Zeit Beschwerdefreiheit auch bei einem Verschließen des Zahnes eintritt.
Viele Zahnärzte versuchen dabei, Ledermix Paste per Papierspitze in die Kanäle einzubringen. Dies ist jedoch nicht sehr sinnvoll. Die Paste basiert auf wässriger Lösung, Papier entzieht jedoch das Wasser, und die Paste wird entweder extrem hochviskös oder gar fest und kann so gar nicht mehr in die Kanäle eingebracht werden. Der Einsatz eines Lentolo ist hier allemal effektiver und kostet meist sogar weniger Zeit.
Danach wird der Zahn dicht verschlossen und der Patient zur Weiterbehandlung in etwa 7 Tagen einbestellt. An diesem zweiten Termin kann dann am schmerzfreien Patienten eine korrekte Aufbereitung der Kanäle stattfinden und die erste medikamentöse Einlage gegen Calciumhydroxid ausgewechselt werden, um die knöcherne Regeneration am Apex aktiv zu unterstützen.
Bei der ersten Medikation von Ledermix treten laut Ehrmann in keinem Fall postoperative Beschwerden (Perizementitis) auf, man erspart sich so eine nochmals unangenehme Situation mit dem selben Schmerzpatienten.
Die gerne versuchte Mischung von Ledermix mit Kalziumhydroxid mit der Absicht, den Wechsel der Medikation zu umgehen, ist als ineffizient abzulehnen. Antibiotika wirken besonders gut im sauren pH-Bereich, Calciumhydroxid senkt jedoch den pH weit ins alkalische ab, so dass die Wirkung des Antibiotikums eliminiert wird, was jedoch vollkommen unerwünscht wäre. Andererseits wirkt das Corticoid in Ledermix regenerationshemmend, so dass es nicht zu lange zumindest in der Apikalregion liegen bleiben sollte.
Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen kann die Praxis in vertretbarem zeitlichem Rahmen für rasche Schmerzausschaltung des gepeinigten Pateingern sorgen ohne die Prinzipien der minimal invasiven Medizin zu verlassen – denn: minimal invasiv, das heißt auch und insbesondere Zahnerhaltung so lange wie irgend möglich, womit sich die Extraktion als Problemlöser gegen Schmerzen definitiv verbietet. Denn, auch das beste Implantatsystem kann den eignen natürlichen Zahn nie ersetzen…
Dr med dent Gerhard Hetz, München