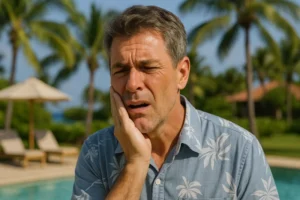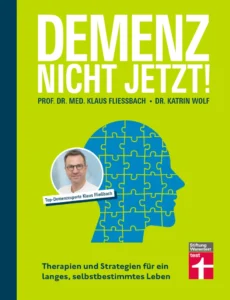Fortbildung – mehr als nur ein Wort!
Jeder Berufstätige weltweit muss sich weiter- und fortbilden, sonst verliert er/sie an Wettbewerbsfähigkeit. Noch nie in der Geschichte der Menschheit gab es so viele Wissenschaftler, die die Grenzen unseres geistigen Horizonts immer weiter in die Ferne schieben. Wer versteht z.B. wirklich noch, was in der Informationstechnologie („Computer“, „Internet“, usw.) geschieht? Schon das ganz alltägliche „Handy“ – seien wir ehrlich, wer kann das tatsächlich noch bedienen in allen Funktionen? Da stellt sich leicht Fatalismus ein: wenn wir sowieso nicht mehr mitkommen mit dem Fortschritt, na ja, dann lassen wir den halt an uns vorbeirasen. Oder, schlimmer noch, man wehrt sich dagegen. Bestes Beispiel war der „Transrapid“, eine eigentlich revolutionäre Technologie, die in die Zeit knapperer Energieressourcen perfekt gepasst hätte. Wenn Autos mit Strom fahren, weshalb dann nicht auch Massentransportmittel? Muss man denn wirklich mit dem Flugzeug von München nach Hamburg, oder wäre da der rasend schnelle Zug mit dem geringen Energieverbrauch nicht besser? Gescheitert ist der Transrapid nicht an den Kosten – die Finanz- und Wirtschaftskrise hat ein zigfaches gekostet, das kann es nicht gewesen sein. Es war die Fortschrittsfeindlichkeit, die das Projekt abgewürgt hat!
Nun gilt diese latente Ablehnung des Fortschritts leider nicht nur für die breite Masse der Bevölkerung, sie gilt auch für unsere kleine Gruppe der Spezialisten in der Zahnmedizin. Zahnärzte waren mal die Speerspitze des Fortschritts – kaum eine Innovaton, die nicht begeistert von den Zahnärzten aufgenommen worden wäre. Das ist aber inzwischen auch Vergangenheit. Wie ich darauf komme? Schauen wir uns mal die „Pflichtfortbildung“ an. Da schreibt der Gesetzgeber vor, dass innerhalb eines Fortbildungszyklus von 5 Jahren 125 Fortbildungspunkte (Zahnärzte) erworben werden müssen, wobei die Punktevergabe relativ großzügig erfolgt. 50 Punkte kriegt man schon mal geschenkt (die werden für „Literatur und Selbststudium“ vergeben, wobei es anzumerken gilt, dass bei der letzten Leseranalyse LAdent immerhin etwa 30 % der Befragten nicht einmal die ZM kannten – Reichweite1 -, und die Lesefreudigkeit der Zahnärzte ist insgesamt nicht berückend). Trotzdem haben im letzten Halbjahr zahlreiche Zahnärzte noch enormen Punktebedarf gehabt – eigene Erfahrungen (!) haben z.B. ergeben, dass noch im zweiten Quartal des Jahres teilweise bis zu 70 (!) Punkte rasch irgendwoher her mussten, um Zwangsmaßnahmen ab Juli abzuwenden. Welche Gründe auch immer angegeben wurden – Fakt ist, diese Kollegen haben keine Fortbildung betrieben. Nun könnte man meinen, nun ja, in der Zahnmedizin gibt es ja keinen so rasanten Fortschritt wie in der Informationstechnologie, da macht das nichts. Da gilt es aber, sich einmal vor Augen zu führen, welche enormen Innovationen wir erlebt haben in den letzten 40 Jahren:
– Einführung der Säure-Ätz-Technik und in Folge die Dentin-Bonding-Technik, die eine revolutionäre Umstrukturierung der konservierenden Zahnheilkunde bewirkt hat – allerdings erkauft mit einer ungeheuren Techniksensibilität mit „Amalgamhonoraren“, die unmöglich eine lege artis Therapie erlauben. Amalgam wird kaum noch eingesetzt, aber, Fortbildung bezüglich „Adhäsivtechnik“ so versichern Wissenschaftler und Fortbildungsinstitute unisono, hat es kaum gegeben. Ob diese Technik so einfach selbst zu erlernen ist?!
Es scheint zumindest nicht so. Der zwingend erforderliche Kofferdam wird gar nicht in der Menge verkauft, dass hier lege artis gearbeitet werden könnte, und die Konditionierung „nach Gefühl“ statt in der geforderten Weise mit Mindestzeiten spricht auch gegen ein Bewusstsein der Problematik. Fortbildung hat auf diesem Gebiet offensichtlich nur sehr begrenzt stattgefunden.
-
Einführung der Implantologie in die ganz normale Praxis: da wurden Fortbildungskurse en masse belegt, hier haben die Zahnärzte wohl gesehen, dass Fortbildungsbedarf besteht und dies umgesetzt.
-
Einführung der Vollkeramik in die Protethik – derzeit werden bereits über 50 Prozent der festsitzenden Restaurationen aus Vollkeramik gefertigt. Nur, bei genauerer Betrachtung wird die Indikation fast generell überzogen, und die Präparationen entsprechen meist auch nicht den Vorgaben (hier kann man interessante Studien treiben, wenn man ein Dentallabor besichtigt). Lege artis ist auch dies nicht.
-
Weiterentwicklung der Endodontie: hier kommt es mittlerweile einem Kunstfehler gleich ohne Mikroskop zu arbeiten. Übersehene Kanäle (bei GKV-Patienten) oder (pikanterweise bei Privatpatienten) sehr kreativgefundene Kanäle (an Frontzähnen können da 4 und mehr Kanäle angegeben werden) sind keine Seltenheit, und die Aufbereitungstechniken sind ebenfalls nicht selten Schnee von gestern. Dafür setzt man gerne den Laser ein, auch wenn es im konkreten Fall unsinnig ist.
-
Weiterentwicklung der Parodontologie: hier ist der lege artis Einsatz regenerativer Materialien eine Seltenheit, man setzt die Materialien schon ein, nur, wegen handwerklicher Mängel bei der Anwendung kommt es zu häufigen Misserfolgen. Die neuen Möglichkeiten der Diagnostik oder des Antibiotikaeinsatzes werden nicht selten gar nicht oder falsch eingesetzt.
Woher das kommen könnte? Die Industrie hat bei Implantaten aktiv für Fortbildung geworben, bei den Kunststoffmaterialien (Adhäsivtechnik) hingegen nicht. Dies gilt auch für Keramik (da gibt’s nur „Produkt-Fortbildungen“, die eben sehr produktbezogen sind) oder die Endodontie – man kann die Beispiele beliebig fortführen.
Und warum? Klar, man wollte das viel teurere Kunststoffsysten in den Markt bringen, und bei qualifizierter Fortbildung hätte man sagen müssen, dass das keine Alterbnative zu Amalgam ist. Also hat man einfach behauptet, Komposit sei eine Alternative, und die Zahnärzte haben das geglaubt. Fragt man kompetente Wissenschaftler, dann sehen die das ganz anders. So ist es auch bei der Vollkeramik – Hauptasache, die Kunden kaufen, und bis die Probleme auftreten gibt es das Produkt schon nicht mehr. Die Laser stehen ja mittlerweile auch meist nutzlos in der Ecke, schade um das schöne Geld, das da (fehl)investiert wurde.
Bisher konnte man das irgendwie hinbekommen – aber, haben Sie mal an die Zukunft gedacht? Wenn das vorgeschriebene QM nicht Arbeitsanweisungen enthält, die lege artis sind – dann kann man das ganz leicht nachprüfen und aufdecken. Regresse sind zwangsläufig die Folge, da kann man sich drauf verlassen. Aber, wie soll man denn QM-Arbeitsanweisungen erstellen, wenn man sich nicht einmal bewusst ist, dass man fehlerhaft arbeitet?!
Und nun kommen wir zum Punkt: die wissenschaftlichen Forbildunsgveranstaltungen sind schwach besucht – man trifft dort immer die selben Kollegen, man kennt sich, und das sind mal grade eine Handvoll – also, mehr als durchschnittlich 1000 Zahnärzte werden es nicht sein, die bei solchen Veranstaltungen präsent sind. Dabei gibt es da die meisten Fortbildungspunkte – ein dreitägiger Kongress bringt satte 24 Punkte, Braucht man nicht mehr zu kommentieren.
Aber, genau auf solchen Tagungen werden die Innovationen kritisch – eben wissenschaftlich – unter die Lupe genommen.
Nun kann man argumentieren, dass die Kosten dafür zu hoch seien – nicht etwa, weil die Teilnehmergebühr an sich zu hoch wäre, es sind die Umsatzausfälle, die die Kosten hoch treiben. Bleibt die Praxis zwei Tage zu wegen Kongressteilnahme, so rechnet sich das gleich mit etwa 6 000 € (errechnet aus den Durchschnittsumsätzen je Arbeitszeit, Basis KZBV Jahrbuch), dazu dann die Teilnehmergebühr und die Übernachtungs- und Reisekosten, da versteht man schon, dass diese Tagungen eine interne Angelegenheit der Universitäten geworden sind.
Um solchen Zwängen zu entgehen, sind innovative Lösungen gefordert. Beispiel wäre eine Video-Fortbildung (z.B. www.dentalkolleg.de), mit deren Hilfe man sich die aktuellen Kenntnisse (wie sie auf den Tagungen vorgestellt werden) erwerben kann, ohne die hohen Nebenkosten. Läßt sich ja ziemlich einfach realisieren: da geht einer zur Tagung und erzählt die Ergebnisse konzentriert vor der Kamera, oder, man kann sogar die ganze Tagung aufzeichnen – komprimiert wär´s jedoch zeitsparender. Oder, wie es manche Hersteller anbieten, man kann eine Tagung gleich online verfolgen – da besteht jedoch wieder die Gefahr der Einflussnahme und daraus resultierend der mangelnden Objektivität.
Die Praktikerfortbildungen haben ein ähnliches Manko:sie sind zwar perfekt für die Bedürfnisse des praktizierenden Kollegen zugeschnitten – nur, wer kann schon beurteilen, ob der Vortragsinhalt tatsächlich den aktuellen Erkenntnissen entspricht? Das kann nur, wer auch die wissenschaftlichen Tagungen besucht, und diese regelmäßig. Ein Dilemma, das nicht leicht zu lösen ist. Hier sollte man nur den Anbietern vertrauen, die auch die nötige Kompetenz mitbringen – also, fragen Sie, ob die Kollegen Referenten auch wirklich regelmäßig auf den einschlägigen Kongressen waren!
Und das QM? Nun ja, da muss man halt eines anschaffen, das ebenfalls von glaubwürdigen Kollegen erstellt worden ist und das alle wichtigen Vorgaben erfüllt (z.B. www.gh-praxismanager.de), dann kann man die Vorgehensweise in Kombination mit Fortbildung koordinieren. Fortbildung ist eben nicht nur ein Wort – das muss konkret umgesetzt werden!
gh