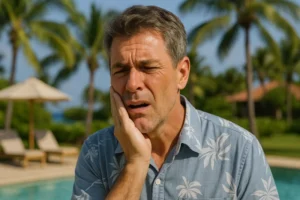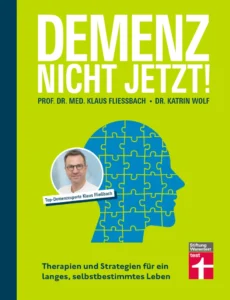Parodontologie heute:
Der PAR gehört die Zukunft!
Inhalte auch als Fortbildungs-DVD werhältlich!
Nach neueren Querschnittsuntersuchungen muss man davon ausgehen, dass mindestens ein Drittel der deutschen Bevölkerung an einer schweren, unmittelbar behandlungsbedürftigen Parodontalerkrankung leidet. Etwa ein mindestens weiteres Drittel weist moderate Formen parodontontaler Destruktion bzw. Vorstufen dazu (wie manifeste Gingivitis, Retraktionen der buccalen bzw. lingualen Gingiva, etc.) auf. Nach Angaben der WHO ist dies ein nicht nur auf Deutschland bezogener Morbiditätsstand, es ist eine weltweit verbreitete Problematik. Denselben Quellen entsprechend gehen so mehr Zähne wegen parodontaler Vorgänge verloren als durch die immer noch weit verbreitete Karies1(Abb. 1 a, b, c). Es besteht also ein erheblicher Behandlungsbedarf, der durch die derzeit abgerechneten Fallzahlen keinesfalls abgedeckt ist2. Dabei ist eine Parodontitis nicht nur ein lokales, die Mundhöhle betreffendes Geschehen, wie internationale Quellen zeigen: die chronische Parodontitis hat erhebliche Auswirkungen auf den Gesamtorganismus (siehe Abb.2)3. Deshalb ist in Zukunft sicherlich auch mit einer noch verschärften rechtlichen Problematik zu rechnen; derzeit ist es jedoch auch schon unzulässig, bei bestehender parodontaler Erkrankung weitergehende Therapien, z.B. ZE-Maßnahmen, vorzunehmen4. So lässt sich folgern, dass es nicht nur eine moralische Pflicht, sondern auch von Gerichten in Urteilen geforderte rechtliche Notwendigkeit gibt, Patienten mit parodontalen Erkrankungen zu therapieren.
Gleichzeitig ist es undenkbar, lediglich eine chirurgische Intervention an erkrankten Parodontien vorzunehmen, ohne die Ursachen dieser Erkrankung, nämlich die ungenügende bzw. fehlerhafte individuelle Mundhygiene der Patienten zu beeinflussen5. Einer jeden PAR-Therapie ist deshalb eine Verhaltensänderung der Patienten vorzuschalten, die naturgemäß auch vor Beginn einer chirurgischen Intervention zu verifizieren ist. Eine solche Neujustierung des Patientenverhaltens kann sinnvollerweise nur nach verhaltenstherapeutischen Prinzipien erfolgen – hier kann man auf jahrzehntelange Erfahrungen der dafür bestens qualifizierten Psychotherapeuten zurückgreifen und braucht keine eigenen Experimente zu machen6.
Es ist also zu folgern, dass es zwingend erforderlich ist, neben parodontologischen Leistungen auch die Prophylaxe in der Praxis anzubieten. Daraus kann dann folgerichtig ein funktionierendes Konzept abgeleitet werden, wie man diese Leistungen zum Nutzen der Patienten und den juristischen Vorgaben entsprechend wirtschaftlich umsetzen kann.
Konzeption
Wie oben erläutert ist zwingend jeder über eine Notfallbehandlung hinausgehenden Therapie eine Abklärung der Mundhygienesituation vorzuschalten und gegebenenfalls durch Maßnahmen der Individualprophylaxe zu korrigieren. Die derzeitige Situation7 zeigt, dass im überwiegenden Teil der Fälle kein adäquates Mundhygieneverhalten vorzufinden sein wird, d.h., eine Vorschaltung der „Professionellen Prophylaxe“ ist überall dort erforderlich.
Dazu bedarf es jedoch struktureller Veränderungen in den Praxen, da es undenkbar scheint, Präventionsleistungen nur „so nebenher“ anzubieten8 9.
Die Einrichtung einer eigenen „Abteilung Prophylaxe“ scheint nach Auffassung des Autors unverzichtbar und kann die Organisation deutlich verbessern. Dazu bedarf es relativ geringer Investitionen10, die höchsten Kosten lösen dabei, wie generell in Deutschland, die Mitarbeiter aus11. Deshalb ist der Produktivität der Mitarbeiter besondere Aufmerksamkeit zu schenken, hier liegen enorme wirtschaftliche Reserven, die bei lediglich auf Assistenztätigkeiten oder Abrechnung bezogenen Tätigkeiten von Mitarbeitern nicht zu schöpfen sind. Der selbständige Einsatz, motiviert durch Beteiligungsmodelle, kann als wichtige Quelle zur Steigerung der Praxis-Kenndaten (Relation Umsatz/Ertrag) dienen.
Wird die Prophylaxe vollständig delegiert, kommt dem Praxisinhaber lediglich noch eine Kontroll- und Steuerungsfunktion zu.
Das Schema muss dann folgendermaßen aussehen:
Patientenaufnahme (Rezeption)
Zuweisung zur „Professionellen Prophylaxe“
Nach Erreichung der vorgegebenen Ziele (API > 30) Weiterleitung zur parodontologischen Diagnostik (PSI)
Entscheidungsfindung, ob PAR-Therapie oder nicht
ggflls. PAR-Therapie
Nach Abschluss PAR bzw. nach Prophylaxe weitergehende Therapien (ZE, Implantologie, etc.)
Verfolgt man ein solches Konzept konsequent genug, so werden die Praxisumsätze erheblich zu steigern sein, ohne dass gleichzeitig die Kosten unangemessen mit angehoben werden – die Praxis-Kennzahlen können so deutliche Verbesserungen erfahren. Dabei sind nicht nur die reinen Umsätze aus Prophylaxe oder Parodontologie zu sehen, es fallen vermehr auch höherwertige Leistungen (z.B. hochwertiger ZE, Implantate) zusätzlich an (Abb.3)
Es ist jedoch wirklich von wesentlicher Bedeutung, ein solches Konzept nicht willkürlich zu durchbrechen, das demotiviert die Mitarbeiter und bringt nur unnötige Unruhe ins Team.
PAR-Diagnostik
Nach wie vor entscheidend ist für eine Parodontaldiagnostik die Messung der Taschentiefen. Hier stehen geeignete Hilfsmittel reichlich zur Verfügung (WHO-Sonde, Formblätter PSI) (Abb. 4,5). Erst wenn eine konventionelle PAR-Therapie (Kürettagen) wenig oder nicht erfolgreich verlaufen ist, wird der Einsatz mikrobiologischer Testverfahren als sinnvoll angesehen12. Die prinzipielle Verwendung von Tests wäre m.E. unwirtschaftlich und die so eingesparten Eigenmittel der Patienten sind anderswo sicherlich sinnvoller einzusetzen. Die „normale“ Parodontitis basiert nämlich auf einer „Erwachsenenparodontitis“, die durch keine Besonderheiten in den verursachenden Keimen ausgezeichnet ist. Lediglich ein sehr kleiner Prozentsatz der Fälle zeigt Sonderformen (RPP – rasch progressive Parodontitis, Juvenile Parodontitis, usw.), und diese können nach erfolgloser Vorbehandlung besser identifiziert werden bei deutlich geringerem Aufwand.
Finden sich nach Kürettage der betroffenen Parodontien immer noch deutlich aktive Taschen (Blutung), so sind mikrobiologische Tests angezeigt13 (Abb. 6).
Es ist Auffassung des Autors, dass vor größeren Lappen-OP´s oder gar regenerativen Maßnahmen (Membranen oder Gele) weitestgehende Keimfreiheit gewährleistet sein sollte, um eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit zu erreichen. In nach wie vor entzündlich reagierenden Parodontien ist die Prognose hingegen schlecht. Andererseits sind Lappen-OP´s relativ aufwändig und wegen der Ergebnisse (Retraktion der Gindiva mit häufiger Freilegung der Furkationen, in der Front Ausbildung von ästhetisch ungünstigen „Spargelzähnen“) – es erfolgt kaum eine bindegewebige bzw. knöcherne Regeneration, so dass maximal überlanges Saumepithel entsteht, das besonders Rezidiv-anfällig wäre – wirtschaftlich kaum zu rechtfertigen. Besser wäre es vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, solche größeren Operationen nach entsprechender Vorbehandlung (Sicherstellung der Keimfreiheit) gleich regenerativ zu therapieren14.
Es ist deshalb zwingend, an dieser Stelle eine antibiotische Therapie vorzuschalten (Abb. 7)15.
Den obigen Ausführungen folgend wird folgendes
Therapieschema
vorgeschlagen:
Primärdiagnostik
Patientenselektion (Therapiebedürftigkeit bejaht? Therapiewürdigkeit bejaht? Wirtschaftliche Voraussetzungen bejaht?)
Primäre PAR-Therapie (Kürettagen)
Sekundärdiagnostik (ggflls. Keimdiagnostik)
Ggflls. Antibiotikagabe
Zweite Keimdignostik (zur Abklärung, ob nun Keimfreiheit gegeben ist)
„große“ OP´s (regenerative Verfahren)
Nachkontrolle
Ganz wichtig: Weiterführung der Prophylaxe (Recall)
Abrechnung
Im Bema 2004 ff wird lediglich einmal jährlich eine „Zahnsteinentfernung“ gewährt sowie im Zweijahresabstand eine parodontale Frühdiagnostik (PSI). Die Diagnostik ist wohl als ausreichend anzusehen, eine Entfernung harter Beläge lediglich im Jahresturnus (nach Bema) ist jedoch ungenügend und muss durch das Angebot der privat abzurechnenden „Professionellen Prophylaxe“ zumindest flankiert wenn nicht ersetzt werden16. Die Prophylaxeleistungen müssen vor (natürlich) und lebenslang nach einer PAR-Therapie angeboten bzw. vom Patienten in Anspruch genommen werden, um den Erfolg zu sichern. Die Prophylaxe als elementaren Teil der Parodontologie zu betrachten ist obligat.
Parodontologische Leistungen als solche wurden im Bema 2004 massiv abgewertet (um etwa 40 Prozent) und wären zu diesen Konditionen nur als Kürettagen durch eine Mitarbeiterin zu erbringen. Derzeit fehlt dazu jedoch die Rechtsgrundlage: laut Zahnheilkundegesetz darf eine Mitarbeiterin nur die im Gesetz explizit genannten Tätigkeiten ausüben, dazu gehört nicht die Behandlung von erkrankten Parodontien in Form von Kürettagen, die damit nach wie vor dem Zahnarzt vorbehalten sind. Zuwiderhandlungen werden im Streitfall als Körperverletzung im Sinne des Strafgesetzbuchs zu sehen sein, mit entsprechenden unangenehmen Folgen. Hier ist dringend eine Novellierung und Anpassung der einschlägigen Bestimmungen einzufordern.
Nach derzeitiger Rechts- und Gebührenlage ist es unmöglich, auch nur Kürettagen zu Lasten der GKV zu erbringen, hier muss eine Abdingung stattfinden. Anderslautende Behauptungen von Seiten der Krankenkassen können nur als plumpe Propaganda und Verdrehung von Tatsachen gesehen werden – wenn die GKV will, dass Kürettagen von Mitarbeiterinnen erbracht werden, dann muss sie dafür sorgen, dass die Gesetze dies auch gestatten!
Große Lappen-Operationen (die, wie oben dargestellt, als alleinige Leistungen als unwirtschaftlich angesehen werden) sind dann ausnahmslos nach GOZ zu leisten – auch hier lässt die GKV gar keine andere Wahl, wie leicht nachgewiesen werden kann. Nach Bema ist ein Behandlungsbedürftigkeit erst ab einem PSI von 3 und mehr anzunehmen – bei den 3,5 mm Taschentiefe (PSI 3) ist jedoch im Seitenzahngebiet immer die Furkation betroffen (Furkationsbefall reduziert die Prognose gewaltig!), im Frontzahnbereich sind ästhetisch äußerst ungünstige Ergebnisse unvermeidbar mit der Folge eines unzufriedenen Patienten. Laien stellen sich unter „Parodontose“ ja gerade den Rückgang der Gingiva vor und nicht die mit Schwellungen verbunde Entzündung.
Der mikrobiologische Keimtest wird weder von Bema noch von GOZ erfasst und ist deshalb nach rein privater Vereinbarung (§ 2 GOZ) abzurechnen, ebenso wie die folgende Antibiotikatherapie (auch diese kann weder innerhalb des Bema noch der GOZ korrekt berechnet werden).
Es gibt Vorschläge zur Analogberechnung von solchen Leistungen, es ist jedoch zu beachten, dass durch das BGH-Urteil vom Mai letzten Jahres17 die Berechnung von Materialkosten bei Leistungen aus dem Gebührenkatalog der GOZ nicht mehr möglich sind (Ausnahme: Implantatbohrer), und da die Materialkosten hier erheblich sind, sind solche Vorgaben mittlerweile obsolet geworden.
Ebenfalls nach freier Vereinbarung (§ 2 GOZ) sollte man auch die folgenden regenerativen Therapieschritte ansetzen; auch dabei gilt, dass bei Ansatz von Analogpositionen aus der GOZ die Weitergabe der Materialkosten untersagt worden ist. Lediglich bei Ansatz von Analogpositionen aus der GOÄ gilt, dass Material berechnet werden darf18.
Bei der Komplexizität der heutigen Rechtslage ist einer von Beginn an korrekten Vorgehensweise besondere Aufmerksamkeit zu schenken; insbesondere müssen die Vorgaben des Gesetzgebers bzw. der Gerichte beachtet und das eigene Verhalten der Rechtsentwicklung permanent angepasst werden. Beispielhaft sein hier angeführt, dass nur nach rechtswirksam erfolgter Beratung und Aufklärung sowie korrekt abgeschlossenen Behandlungsverträgen eine korrekte Rechnungsstellung erfolgen kann, andernfalls man auf den guten Willen des Zahlungspflichtigen angewiesen wäre – bei den geringsten Formverstößen wird von den Gerichten die Zahlungspflicht des Patienten verneint bzw. deutlich beschränkt19. Insbesondere gilt dies für die Berechnung von ZE-Leistungen: hat der Zahnarzt vergessen oder übersehen, dass eine PAR-Therapie nötig gewesen wäre, entfällt sein Anspruch auf Zahlung der Rechnung vollständig, zusätzlich wird er mit einem Schmerzensgeld belegt, das zwar von der Haftpflichtversicherung übernommen wird, bei groben Pflichtverletzungen aber als Regress von ihm zurückgefordert werden kann. Und wenn sich ein Patient trotz korrekter und intensiver Aufklärung einfach nicht dazu bereit erklärt hat, Prophylaxe und PAR-Therapie in Anspruch zu nehmen? Dann hat der Zahnarzt pflichtgemäß auch die Anfertigung von Zahnersatz abzulehnen – Ausnahme: Vollersatz oder Teilprothesen mit gebogenen Klammern. Kann man in Urteilen nachlesen…
Mustervereinbarungen und Patienteninfos unter http\www.dentalspiegel.de
Im Kasten:
Prinzipien der Verhaltenssteuerung
Einmal erlerntes Verhalten ist extrem stabil
Das Verhalten wird nur geändert, wenn es dafür eine starke Motivation gibt
Mögliche Motivation:
-
Leiden (Schmerzen, Lustentzug, fehlende Zuwendung)
-
Interne Motivation durch Einsicht (extrem selten und gering wirksam)
-
Externe Motivation durch Belohnung oder Bestrafung (z.B. Geldstrafe, Freiheitsentzug oder umgekehrt besondere Zuwendung, geldliche Belohnung, etc.)
Prinzip: wird ein anderes (eher erwünschtes Verhalten) gezeigt, so erfolgt unmittelbar eine Belohnung, bei Fehlverhalten sofort eine Bestrafung
Zeitlich versetzte Belohnung oder Bestrafung wirken nicht!
Kleine Schritte:
Nur dann, wenn die Verhaltensänderung rasch, relativ leicht und von unmittelbarem Erfolg (Belohnung!) gefolgt ist, kann sie durch weitere Einübung (Wiederholungen!) manifestiert werden und wird dann dauerhaft gezeigt.
Deshalb: kleine Schritte vorsehen (z.B. nur einen Quadranten perfekt putzen lassen, nur in einem Quadranten die Interdentalhygiene anwenden lassen, nur in der Front Interdentalhygiene anwenden lassen, usw.), die einen sichtbaren Erfolg bringen (regelmäßig anfärben) und belohnt werden (z.B. durch Lob, durch Reduktion des abverlangten Honorars für die PZR, usw.) und unmittelbar nutzen (indem also ein Zahnabschnitt erkennbar sauber ist).
Kleine Schritte auch bei der Ernährungslenkung: zuerst ein Ernährungsprotokoll anlegen lassen und dann nur wenig ändern, z.B. die erste Zuckeraufnahme erst ab Mittag und nicht schon morgens. So funktioniert auch die Raucherentwöhnung – da wird in festem Rahmen der Zeitpunkt der ersten Zigarette immer weiter nach hinten verschoben.
Keine Änderung verlangen, die nicht sofort erreicht werden kann!
Ganz wichtig: Bestrafung und Belohnung nicht vergessen! Dazu ist es sinnvoll, präzise Aufzeichnungen zu führen und „Hausaufgaben“ aufzugeben, die dann kontrolliert werden. Wurden die Aufgaben zufrieden stellend abgearbeitet, so muss belohnt werden (siehe oben), bei schlechter Aufgabenerfüllung muss bestraft werden (siehe oben).
Kaum ein Patient kann langfristig denken (perspektivisches Denken ist in der Bevölkerung wenig verbreitet), rationale Argumente sind sinnlos, da dazu die Intelligenz der Patienten nicht ausreicht (siehe PISA 2!). Emotionale Einflüsse überwiegen (Beispiel: Esoterik, Geisterglaube, „Bio“, usw.), hier kann die Mitarbeiterin effektiv eingesetzt werden (bei Männern, Sex ist wichtig!), oder der Chef zeigt, dass ihm die Patientin mit saubereren Zähnen besser gefällt (wirkt unbewußt und deshalb besonders gut).
1 Hetz, G.: ZM 94 Nr. 5, S. 518 ff., Deutscher Zahnärzteverlag, Köln, 2004
22 KZBV Jahrbuch, KZVB, Köln, 2003
33 Hetz, G.: Aktueller Stand der Parodontologie, Spitta-Verlag, Balingen
4 Hetz, G.: Aktueller Stand der Parodontologie, Spitta-Verlag, Balingen
5 Hetz, G.: Parodontologie in der Praxis, Deutscher Zahnärzteverlag, Köln, 2003
6 Hetz, G. und Hendriks, J.: Prophylaxe in der Praxis, Deutscher Zahnärzteverlag, Köln, 2004
7 Schneller et al, Individualprophylaxe bei Erwachsenen. Erfahrungen, Problemsichten und Perspektiven bei niedergelassenen Zahnärzten in Deutschland. IDZ-Information 4/2001, Deutscher Zahnärzteverlag, Köln, 2001
8 Hetz, G. und Hendriks, J.: Prophylaxe in der Praxis, Deutscher Zahnärzteverlag, Köln, 2004
9 Hetz, G.: Dental Spiegel 1 2005, Franz Medien, München
10 Hetz, G. Dental Spiegel 1 2005
11 Hetz, G. Dental Spiegel 1 2005
12 Hetz, G.: „Praxisgerechte Diagnostik und Therapie der Parodontitis“, S. 159 ff., Deutscher Zahnärztekalender 2002, Deutscher Zahnärzteverlag, Köln, 2003
13 Hetz, G. Parodontologie in der Praxis, Deutscher Zahnärzteverlag, Köln, 2003
14 Hetz, G. Parodontologie in der Praxis, Deutscher Zahnärztverlag, Köln, 2003
15 Hetz, G. Aktueller Stand der Paqrodontologie, Spitta-Verlag, Balingen (Lose-Blatt-Werk mit jährlich 4 Aktualisierungen)
16 Hetz, G. Dental Spiegel 1 2005, Franz Medien, München
17 BGH, AZ ….
18 Hetz, G. Aktuelle Musterschreiben zur Entgegnung von Einwänden privater Krankenversicherungen, Form Verlag Gesundheitsmedien, Merching
19 Hetz, G. Musterschreiben