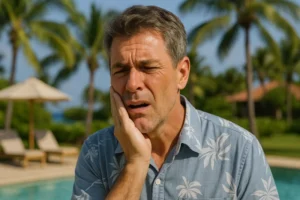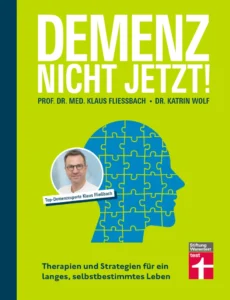Praxislabor – Geldquelle oder Kapitalvernichtung?
Wann sich ein Praxislabor lohnt und was man besser ins gewerbliche Labor gibt.
Dr. Gerhard Hetz
Eigentlich hat jeder Zahnarzt ein Praxislabor – zumindest ein kleiner Arbeitsplatz für Prothesenkorrekturen, Arbeiten an individuellen Löffeln oder ähnliches ist bei allen vorhanden.
Nur, ein richtiges „Praxislabor“ ist schon ein bisschen größer. Es gab Zeiten, in denen im Praxislabor mehr Umsatz gemacht worden ist als in der Praxis, da arbeiteten nicht selten drei oder mehr Techniker für einen Zahnarzt. So lange ist das gar nicht her – und heute sind Zahntechniker wenn nicht arbeitsl0os so doch in andere Berufe abgewandert, die Umstrukturierung war gnadenlos und innerhalb kürzester Zeit zu vollziehen. Woran das liegt? Keine Frage, die Politik hat erst das Geld mit vollen Händen ausgegeben (wer erinnert sich noch, Brücken, voll keramisch verblendet, von 8 bis 8 wurden zu 100 Prozent von jeder AOK auch für Asylanten bezahlt, was ein Anspruchsdenken der Patienten begründet hat, unter dem wir heute noch zu leiden haben) und dann wurde wieder eingesammelt: Kürzungen über Kürzungen, jedes Mal, wenn es eine neue Zuzahlung für Patienten gegeben hat wurde auch der „Leistungserbringer“ mit Honorarabzug bestraft. Bisher hat es die Techniker nicht getroffen, die haben keine Preisabschläge hinzunehmen gehabt wie die Zahnärzte. Nur, jetzt sind die Umsatzzahlen ganz weggebrochen: es gibt nichts mehr zu tun für Deutschlands Zahnlabors, oder, zumindest sehr viel weniger. Trotzdem, bei einer auch nur etwas anspruchsvolleren prothetischen Arbeit beträgt der Zahntechnikanteil immer noch etwa zwei Drittel, der Zahnarztanteil ein Drittel des Gesamtpreises. Da überlegt man schon, ob man das Geld nicht lieber in der Praxis lässt anstatt es an ein Fremdunternehmen auszugeben.
Zusätzlich eröffnen sich durch die Globalisierung ganz neue Möglichkeiten – es ist kein Geheimnis, dass über das Praxislabor schon lange Arbeiten, die in Fernost von den dort doch erheblich billigeren Technikern erbracht worden sind, „reingewaschen“ wurden. Die Praxis stellt die Rechnung (nach deutschen Sätzen), bezahlt wird jedoch nach Rechnung Fernost, die erheblich niedriger ausfällt. Das ist zwar eine juristische Grauzone, in der sich diese Praxen bewegen – nur, es wird gemacht, siehe „Globudent“ (da war´s ein gewerblicher Vermittler, aber, das kann ja jeder Zahnarzt selber). Und ein Problem totschweigen löst es ja nicht.
Nun haben sich auch Deutschlands Zahntechniker zu Preisnachlässen bereit gefunden – wir müssen uns nur mal die Werbeaktivitäten ansehen. Wer mit „seinem“ Zahntechniker ein ernstes Wort redet wird ganz rasch Erfolg haben und deutlich niedrigere Einstiegspreise bewirken. Verhandeln – feilschen – lohnt sich…
Da wird doch das Praxislabor erst Recht unökonomisch?
Richtig, so könnte es ein – muss es aber nicht. Man sollte nur ganz genau hinschauen, was man im Eigenlabor machen will und was man ins gewerbliche abgibt.
Das Praxislabor –
Welche Gewinnchancen?
Ein Minimallabor (kleinste Größe, Herstellung von Modellen, Schienen, etc.) ist zu veranschlagen mit etwa 10 000 € – daraus errechnen sich Abschreibungen in Höhe von 10 bis 15 Prozent, entsprechend 1 000 bis 1500 € pro Jahr. Die Rechnung:
Investition, Abschreibungen, monatlich 100 €
Zinsen bzw. Investitionsgewinn 7,5 Prozent 60 €
Raumkosten (Miete, Nebenkosten) 200 €
Monatliche Gesamtkosten 360 €
Personalkosten fallen in diesem Fall nicht an, da die Arbeiten von einer Mitarbeiterin der Praxis oder vom Zahnarzt selbst ausgeführt werden können.
Es lohnt also in jedem Fall, ein Kleinlabor einzurichten – schon 2 Schienen sowie die notwendigen Modelle (für Planung usw.) decken die monatlichen Kosten, darüber hinaus wirft das Kleinstlabor satte Gewinne ab.
Zu beachten ist dabei, dass es aus rein technischen Gründen immer erforderlich sein wird, ein kleines Praxislabor vorzuhalten: es ist kaum realistisch – will man Präzisionsarbeiten abliefern – z.B. Alginatabformungen (noch bedenklicher: reversible Hydro-Abformungen) ins Labor zu schicken. So wäre keinesfalls die erforderliche Präzision zu erreichen, abgesehen davon, dass es auch aus Gründen des Infektionsschutzes besser ist, Alginatabformungen in der Praxis in Modelle zu überführen (Alginatabformungen sind kaum wirklich desinfizierbar, und nach den Vorschriften der Berufsgenossenschaft ebenso wie der Gewerbeaufsicht darf aus Hygieneschutzgründen kein so stark kontaminiertes Zwischenprodukt, wie es eine frische Alginatabformung zweifellos darstellt, die Praxis verlassen. Es ist also mindestens erforderlich, Alginatabformungen innerhalb der Praxis auszugießen, eine andere Systematik ist nur schwer vorstellbar.
Hier steht also gar nicht der Gewinn, sondern die Arbeitssicherheit im Vordergrund.
Daneben rechnet sich die Herstellung von Schienen sicherlich sehr gut für die Praxis, da Schienen (die als „Kieferbruch“ abgerechnet werden) voll auch von den Sozialkassen bezahlt werden, ohne Eigenbeteiligung der Patienten. Ein kleines Praxislabor ist also auch bei Betrachtung der rein finanziellen Seite interessant.
Das Labor mittlerer Größe, in dem auch Reparaturen übernommen werden können, ist nur unwesentlich teurer und soll hier gar nicht separat kalkuliert werden. Denn, ein Drucktopf kostet ja nun mal wirklich nicht die Welt, und einen Technikmotor kann sich auch Jeder leisten.
Hat die Praxis die Ausrüstung, um Reparaturen sofort und ohne Umwege selbst vorzunehmen (denken wir an den Bruch einer Vollprothese), so erreicht sie dadurch eine wesentlich bessere Patienten-/Kundenbindung, und das praktisch zum Nulltarif.
Das „richtige“ Praxislabor hat einen ganz anderen Kalkulationsansatz. Hier sind Investitionen ab 50 000 € anzusetzen (z.B. Minimallabor und ein CEREC, oder Ausstattung für Gold-Arbeiten, usw.).
Die Kalkulation wäre dementsprechend:
Investitionsabschreibung monatlich 600 €
Zinsen bzw. Investitionsgewinn 300 €
Raumkosten 300 €
Personalkosten (Zahntechniker, fest angestellt) 4 000 €
Material 500 €
(im Kleinstlabor ist das eine vernachlässigbar kleine Größe!)
Monatliche Gesamtkosten 5 700 €
Hier muss ganz anders geplant werden, denn Kosten von ungefähr 6 000 € pro Monat können zu einer ganz unangenehmen Belastung werden.
Das rechnet sich dann, wenn der Techniker voll arbeitet (davon muss man ausgehen, sonst lässt man es besser): der Tagesumsatz eines Zahntechnikers liegt bei etwa 2 000 €, wenn er wirklich arbeitet.
Oder, nehmen wir ein CEREC: je Inlay ist es realistisch, 150 bis 200 € zu berechnen – man kann auch mehr nehmen, aber, da wäre der Wettbewerbsvorteil eventuell nicht mehr gegeben. Individualisiert der Techniker die CEREC-Restaurationen, dann kostet das natürlich extra. Bei Goldarbeiten sollte die Technik auch nicht mehr als 200 € je Zahn kosten – mehr als 2 Gramm Gold (Durchschnitt Inlays und Kronen) je Restauration sollten überdacht werden, da hat man einfach zu dick modelliert. Die Kosten für Edelmetall oder Keramik-Material sind dabei in der Modellrechnung berücksichtigt!
Also, man muss etwa 30 Restaurationen pro Monat im Labor herstellen lassen, um auf der sicheren Seite zu sein. Dabei sind dann Schienen, Modelle usw. der echte Zugewinn, denn die werden (das ist sinnvoll) immer noch von der Praxismitarbeiterin übernommen, und das ist dann schon ein guter wirtschaftlicher Erfolg.
Allerdings bleibt hier immer die Frage nach den Umsatzerwartungen – nur dann, wenn die hohen hiesigen Zahntechnikpreise gegenüber den Patienten durchsetzbar sind (z.B. weil man überwiegend Patienten mit Privatversicherungen hat), lässt sich diese Modellrechnung umsetzen. Die selbst zahlenden Patienten werden jedoch den Preis zu drücken versuchen, und da ist es allemal besser für den Zahnarzt, sein eigenes Honorar in voller Höhe bzw. auch zu einem höheren, nicht erstattungsfähigen Satz, durchzusetzen als an den Zahntechniker weiterzugeben. Bei einem solchen Klientel (dazu zählen sicherlich das Gros der GKV-Patienten) sollte man den Weg der abgesenkten Technikkosten suchen – so, wie er oben beschrieben worden ist.
Eine dazwischen anzusiedelnde Alternative wäre die Beschäftigung eines Technikers auf Stunden- bzw. Umsatzbasis, d.h., der Zahnarzt stellt die Infrastruktur zur Verfügung und der Techniker arbeitet nur nach Bedarf. Bei diesem Modell ist man flexibler, denn, dass sollte man immer sehen, die höchsten Kosten sind bei uns immer die Personalkosten! Investitionen in Ausrüstung und Geräte sind vergleichsweise spottbillig.
Große Praxislabore, wie man sie vor zehn und mehr Jahren gesehen hat, sollten heute kaum noch Bedeutung haben – die Prothetik-Umsätze je Zahnarzt sind dazu einfach zu gering geworden. Nur noch Gemeinschaftspraxen kommen dafür in Frage – aber, da sind wir bei Umsatzklassen (Praxis) von weit jenseits der 500 000 € jährlich.
Für die Durchschnittspraxis mit cá 350 000 € Jahresumsatz (Quelle: KVBV Jahrbuch) fallen Ausgaben für „Fremdlabor“ in Höhe von etwa 1/3 der Gesamtkosten an, Material für Praxis und Eigenlabor hingegen verschlingen lediglich 9 Prozent, Fremdlabor und Personal hingegen kosten je 1/3 (auch die praxiseigenen Mitarbeiter sind eben sehr teuer). Aus den betriebswirtschaftlichen Daten lässt sich auch die Aussage, die Kosten für Investitionen in Geräte usw. seien lächerlich gering im Vergleich zu den Aufwendungen für Personal, leicht belegen: durchschnittlich 11 Prozent werden für Zinsen und Abschreibungen aufgewendet, also nur ein kleiner Bruchteil dessen, was man für die Mitarbeiter ausgeben muss.
Das gilt immer unter der Prämisse, die Arbeitskosten fielen im Inland an – im Ausland arbeitet man zu einem Bruchteil unserer Kosten. Es ist ernsthaft darüber nachzudenken, analog der Industrie den Weg zu gehen, das Ausland als „verlängerte Werkbank“ einzusetzen, um die Wertschöpfung hierzulande (also bei uns in der Praxis) zu verbessern.
Will man diesen Weg konsequent gehen, so wird man ebenfalls nicht ohne Techniker auskommen: die Arbeiten, angeliefert von weit her, müssen unter Umständen hier nachgearbeitet bzw. angepasst werden – das macht keinen Sinn, die dann mehrmals hin und her zu schicken. Nur wird das Tätigkeitsfeld des Technikers dann ein ganz anderes sein als wir es von früher her kennen!
Dr. Gerhard Hetz Zahnarzt Winkstraße 5 81373 München gh@hetz-publikationen.de