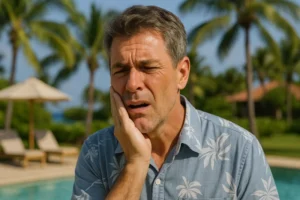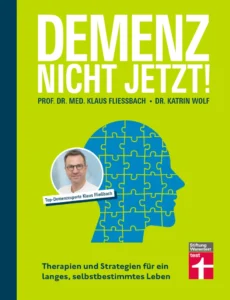1 Einleitung
Die Medizin muss, will sie Gesundheitsgefahren bannen und zum Wohl der Patienten Neuland erschließen, selbst Risiken eingehen. Wenn sie sich mit einer Fülle verschiedenartiger Wagnisse konfrontiert sieht, liegt dies daran, dass durch das exponentielle Wachstum der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und der Technologien die Möglichkeiten medizinischen Eingreifens stark zugenommen haben [18]. Behandlungsrisiken sind sehr vielfältig. Sie können zu Haftungsrisiken werden [4] (Tab. 1).
#Tab. 1#
2 Vorbemerkungen
Um den Misserfolg, der gerichtliche Auseinandersetzungen zur Folge haben kann, zu vermeiden, ist die Erhebung der Anamnese (sie ist Teil des Behandlungsvertrages) vor Beginn bzw. Übernahme der Behandlung von großer Bedeutung. Sie erfordert nicht nur allgemeines Basiswissen, sondern auch mancherlei spezielles Fachwissen.
Der größte Fehler des Behandlers besteht darin, dass er der Anamnese keinen oder nur einen geringen Wert beimisst, ja sie für überflüssig erachtet.
Das kann, wie sich in der psychosomatischen Sprechstunde immer wieder herausstellt, besonders bei Patienten mit orofazialen Somatisierungsstörungen zu folgenschweren Fehlbehandlungen führen. Wie eine Gesamtbehandlung als totaler Misserfolg endet und der Patient die Klage einreicht, zeigt Marxkors (1999) paradigmatisch in folgender Fallbeschreibung:
Ein HNO-Arzt überweist per Telefon einen Patienten wegen einer „Trigeminusneuralgie“ an seinen zahnärztlichen Kollegen. Dieser räumt kurzfristig einen Termin ein, lässt sich die Beschwerden im rechten Oberkiefer beschreiben und beginnt unmittelbar danach mit Einschleifmaßnahmen. Die Gesamtbehandlung mit vier Kronen im Unterkiefer und einer fünfgliedrigen Brücke im Oberkiefer führte zum Misserfolg. Die Brücke im Oberkiefer wurde wiederholt und auch die Zweitausfertigung nebst drei Kronen im Unterkiefer musste wieder entfernt und durch Provisorien ersetzt werden. Während der Behandlungszeit, die sich über neun Monate erstreckte, waren die Beschwerden mal weniger stark, mal steigerten sie sich ins Unerträgliche.
Wäre der Zahnarzt um die Vorgeschichte bemüht gewesen, dann hätte er erfahren, dass dieser Patient in den letzten zwei Jahren etwa 70 Termine bei dem überweisenden HNO-Arzt und eine wenigstens zehnjährige Odyssee zwischen HNO-Ärzten, Internisten und Ganzheitsmedizinern hinter sich hatte. Im Rahmen dieser Behandlungen beschrieb der Patient selbst in einem früheren Anamnesebogen seine Beschwerden wie folgt: „ … Schmerzen in verschiedenen Bereichen, Depressionen, Angstgefühle etc. … .“
Angesichts dieser Vorgeschichte bestand eindeutig überhaupt keine Chance, mit zahnärztlichen Maßnahmen allein zum Erfolg zu gelangen [12,14]. Weil keine Anamnese erhoben wurde, fanden auch keine therapeutisch-diagnostischen Abklärungen statt, keine Ermittlung der Schmerzqualität, keine Testanästhesie, kein Provokationstest, kein Resilienztest der Kiefergelenke, keine instrumentelle Funktionsanalyse. Forensisch wird solches als schuldhaftes Fehlverhalten eingestuft, weil Basiswissen in der Psychosomatik vorausgesetzt wird. Die Feststellung, dass die Beschwerden nicht mit den erhobenen Befunden in Einklang zu bringen waren, hätte zumindest den Verdacht auf eine orofaziale Somatisierungsstörung aufkommen lassen müssen [1].
Die Erhebung einer Beschwerdeanamnese ist der immer zwingend notwendige erste Schritt in der Behandlungssequenz.
Um den Gesundheitszustand des Patienten vor Behandlungsbeginn kennen zu lernen und mögliche Risiken infolge vorbestehender Erkrankungen und Allergien/Unverträglichkeiten zu erfragen, bietet sich der Patientenerhebungsbogen an, der alle Forderungen des Datenschutzes erfüllt (Anhang).
3 Zahnärztliche Eingriffe und Endokarditis – Prophylaxe
Patienten mit einem angeborenen Herzfehler stellen die Hauptrisikogruppe für das Auftreten einer infektiösen Endokarditis dar. Im zahnmedizinischen Berufsalltag wird die Endokarditisprophylaxe immer noch unzureichend umgesetzt [7]. Aufgrund der Pathogenese der infektiösen Endokarditis (IE) ist bei zahnärztlichen Interventionen die Möglichkeit präventiver Maßnahmen gegeben (Übersicht 1). Die Zahnärzte sind verstärkt bereits in der Ausbildung darauf hinzuweisen, um sie vor Fehlern größerer Tragweite zu bewahren. Durch zahlreiche zahnärztliche Eingriffe werden häufig Bakteriämien verursacht, die bei prädisponierenden Endokardschädigungen eine mikrobielle Besiedlung nach sich ziehen können [6].
#Übersicht 1#
Im Gefolge zahnärztlicher und zahnärztlich – chirurgischer Eingriffe mit Blutungsgefährdung werden gravierende Bakteriämien häufig, bei Eingriffen, die den Zahnsulkus betreffen, regelhaft nachgewiesen. Dies gilt insbesondere für Zahnextraktionen, intraligamentäre Anästhesien, Zahnsteinentfernungen, Parodontalkürettagen, bei parodontalchirurgischen Eingriffen, Wurzelbehandlungen sowie sonstigen zahnchirurgischen Interventionen. Da die Mundhöhle unter physiologischen Bedingungen von mehr als 200 verschiedenen Bakterienarten besiedelt ist und insbesondere der Zahnsulkus eine besonders hohe Bakteriendichte aufweist, erreichen im Vergleich zu der Mehrzahl sonstiger medizinischer Eingriffe hohe Mengen an Bakterien die Prädilektionsstelle [7]. Bakteriämien im Gefolge zahnärztlicher Eingriffe dauern in aller Regel nicht länger als 15 Minuten über das Ende des bakteriämieauslösenden Ereignisses an. Deshalb ist die einmalige Gabe eines Antibiotikums per os prophylaktisch ausreichend.
Die vorgeschlagenen Prophylaxeregime sind tierexperimentell hinreichend erprobt [3,5,10]. Bei Vorliegen einer Penicillinallergie bietet Clindamycin in der zahnärztlichen Praxis eine gleichwertige Alternative (Tab. 2).
#Tab. 2#
Dies entspricht einer Empfehlung der American Heart Association (AHA) bei Hochrisikopatienten. Amoxicillin per os 60 min vor dem geplanten Eingriff gewährleistet bei guter Verträglichkeit einen ausreichend hohen Serumspiegel, um die Anheftung der Bakterien an den Vegetationen zu vermeiden [2]. Martin et al. (1997) stellten 53 Fälle von Endokarditiden zusammen, die Anlass für zahnärztliche Behandlungsfehlerprozesse wurden. In 48 der 53 Fälle war gar kein Antibiotikum, in je zwei Fällen waren sie entweder unwirksam oder zum falschen Zeitpunkt gegeben worden. Lediglich in einem Fall wurde die Antibiotikagabe korrekt durchgeführt. Im DHZB (Deutsches Herzzentrum Berlin) war in einer retrospektiven Auswertung über einen Zeitraum von zehn Jahren bei vier von 22 Patienten mit angeborenem Herzfehler eine Endokarditis aufgetreten, bei der als wahrscheinlichster Auslöser eine zahnmedizinische Intervention in der Anamnese vorlag [7].
4 Zahnsanierung vor und nach Organtransplantation
Die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde ist in die Vor- und Nachsorgeerfordernisse der bei Organempfängern notwendigen lebenslangen Immunsuppression zur Erhaltung der Transplantatfunktion einbezogen [16]. Bei diesen Patienten besteht wegen der lebensnotwendigen und dauerhaften immunsuppressiven Medikation ein erhöhtes Risiko, an lokalen oder hämatogen fortgeleiteten bakteriellen Infektionen aus der Mundhöhle zu erkranken.
Die Mundhöhle hat natürlicherweise eine vielfältige bakterielle Besiedelung mit Überwiegen einer schützenden physiologischen Streptokokkenflora. Bei der Mehrzahl der erwachsenen Patienten sind daneben auch potenziell pathogene Keime vorhanden, die ihre Hauptlokalisation im Parodont der Zähne haben. Neben besonderen Streptokokkenarten handelt es sich vor allem um Gram-negative anaerobe Bakterien. Qualität und Quantität der Standortflora sind individuell verschieden und im Einzelfall hinsichtlich konkreter pathogener Potenz nicht einschätzbar. Des weiteren ist mit keiner desinfizierenden, antibiotischen oder chirurgisch sanierenden Behandlungsmaßnahme eine keimfreie Mundhöhle herstellbar. Aus der Standortflora der Mundhöhle können über den Zahn als Eintrittspforte bakterielle Infektionen entstehen, die lokal als Parodontitis, Abszess oder Osteomyelitis klinisch manifest werden. Die hämatogene Streuung des potenziell pathogenen Erregergemisches kann im Sinne der „focal dental infection“ zu sekundären bakteriellen Infektionen führen, wie sie für die Endokarditis durch orale Streptokokken bekannt sind. Bei immunsupprimierten Organempfängern haben die ebenfalls im Blut nachweisbaren anaeroben Erreger gleichermaßen pathogene Bedeutung.
Diese Situation erfordert vor der Organtransplantation:
- Klinische und röntgenologische (Panoramaschichtaufnahme) Untersuchung und Dokumentation
- Hygieneinstruktion, professionelle Zahnreinigung
- konservierende Sanierung (Endodontie)
- chirurgische Sanierung
- prothetische Immediatversorgung
- Berichterstattung über abgeschlossene zahnärztliche Sanierung.
Radikale Sanierungsmaßnahmen sind nach dem heutigen Wissensstand nicht zu begründen. Alle Behandlungsmaßnahmen müssen unter Berücksichtigung der Grunderkrankung und in Absprache mit dem behandelnden/betreuenden Arzt ausgeführt werden (bei Dialyse vor Nierentransplantation, Herzinsuffizienz vor Herztransplantation, Gerinnungsstörung vor Lebertransplantation, Diabetes vor Pankreastransplantation u.ä.). Im Einzelfall kann wegen des Risikos allgemeiner Komplikationen die Grenze der ambulanten Behandlungsmöglichkeit in der zahnärztlichen Praxis erreicht sein. Die vollständig abgeschlossene zahnärztliche Sanierung (einschließlich kontrollierter Wundheilung) muss dokumentiert und mitgeteilt werden. Diese Mitteilung ist die Voraussetzung für die Freigabe zur auf Abruf geplanten Organtransplantation.
Analog zu den aktuellen Empfehlungen für die Endokarditisprophylaxe der American Heart Association [2] ist ein erhöhtes Risiko anzunehmen bei:
- Zahnextraktion
- operativer Zahnentfernung
- Wurzelspitzenresektion
- parodontalen Behandlungsmaßnahmen
- PAR – Untersuchung mit Taschensondierung, PAR – Chirurgie
- Zahn- oder Implantatreinigung mit lokaler Blutungsneigung
- dentaler Implantation und Reimplantation
- Endodontie mit Aufbereitung
- intraligamentärer Injektion (Lokalanästhesie).
Alle zahnärztlichen Behandlungsmaßnahmen mit Bakteriämierisiko sind in den ersten drei Monaten nach Transplantation kontraindiziert [16].
5 Zahnärztliche Behandlung von Patienten mit Herzschrittmachern
Es ist notwendig, den Patienten ebenso nach einem Herzschrittmacher zu befragen, wie bei bestimmten Maßnahmen nach einer Allergie oder einer Blutungsneigung. Im Regelfall teilt der Träger eines solchen Stimulationsgerätes allerdings schon vor Beginn der Behandlung mit, dass er Träger eines solchen Gerätes ist. Diese Patienten sind im Besitz eines Ausweises, der Daten über Schrittmachertyp und Funktionsweise, Schrittmacherfrequenz, Elektrodentyp etc. enthält.
Der Herzschrittmacherpatient kann keinesfalls in einer zahnärztlichen Praxis als „Problempatient" angesehen werden. In den Bereich der ganz normalen und auch routinemäßigen Befragung des Patienten zur Vorgeschichte ist auch zumindest bei der älteren Klientel die Frage nach Kreislauferkrankungen einzuflechten. Damit ergibt sich in aller Regel der Hinweis auf einen Schrittmacher oder implantierten Defibrillator (ICD).
Die Beeinflussbarkeit eines Herzschrittmacher-Patienten in einer zahnärztlichen Praxis durch elektromedizinische Geräte ist grundsätzlich möglich, in der Regel aber selten. Die Gruppe der Herzschrittmacher-Patienten bedarf lediglich einer normalen, ausgewogenen und kritischen Aufmerksamkeit des Zahnarztes [9].
6 Zahnärztlich – chirurgische Eingriffe bei Diabetikern
In der Bundesrepublik leiden mehr als acht Millionen Menschen an Diabetes mellitus. Bei längerbestehendem, unzureichend eingestellten Diabetes mellitus kommt es zu Mikro- und Makroangiopathien, die sich als Retinopathie, Glomerulosklerose, Neuropathie und frühzeitige Arteriosklerose manifestieren. Daraus resultiert eine erhöhte Inzidenz für Myokardinfarkte, Apoplexien, Nierenversagen etc. Neben diesen allgemeinmedizinischen Folgen sind für die zahnärztliche Chirurgie die allgemeine Infektanfälligkeit von Bedeutung und für den oralen Bereich die gehäuften Parodontalabszesse, Wundheilungsstörungen nach Extraktionen, persistierende Ulzerationen, Gingivahyperplasien und Mundwinkelrhagaden hervorzuheben.
Bei unklarer Stoffwechseleinstellung, nicht eindeutiger Sicherheit der Insulindosierung und -verabreichung und auch vor Langzeitoperationen ist mit dem behandelnden Arzt Kontakt aufzunehmen. Zu beachten ist, dass Stress (auch die Belastung unter der Operation), lokale Infektionen, eine Kieferklemme und jegliche Nahrungskarenz die Stabilität des diabetischen Zustandes beeinflussen. Hierdurch kann sehr schnell eine Änderung der Insulindosierung und damit eine engmaschige Blutzuckerkontrolle durch den mitbetreuenden Arzt und den Patienten selbst notwendig werden [20].
Cave: Auch Kinder und Jugendliche können vom Typ-II-Diabetes (früher „Altersdiabetes“ genannt) betroffen sein – mit zunehmend ansteigender Häufigkeit. Vor allem bei übergewichtigen Kindern und solchen, bei denen ein Diabetes in der Familie liegt, sollte (auch bei oben angeführten Komplikationen) an die Möglichkeit einer Störung des Blutzucker-Stoffwechsels gedacht werden [19].
7 Zahnärztlich – chirurgische Behandlung von „Marcumar" – Patienten
Ca. 150.000 Patienten nehmen in der Bundesrepublik gerinnungshemmende Mittel ein. Diese große Zahl an Patienten führt dazu, dass in vielen zahnärztlichen Praxen „Marcumar" –Patienten behandelt werden. Deshalb müssen die Behandlungsleitlinien in jeder Praxis bekannt sein [8].
Zur Verhütung von Thrombosen und Embolien werden gefährdete Patienten langfristig mit gerinnungshemmenden Mitteln behandelt. Die dazu verwendeten indirekt wirkenden Antikoagulantien sind Cumarinderivate. Sie verändern den Vitamin-K-Stoffwechsel. Durch Verminderung der wirksamen Form des Vitamin K wird die Synthese der Blutgerinnungsfaktoren II, VII, IX und X wie auch der Inhibitoren Protein C und Protein S in der Leber herabgesetzt. Übliche Handelspräparate sind Marcumar, Falithrom (beide Phenprocoumon) und Coumadin (Warfarin). In Deutschland wird vorwiegend Phenprocoumon eingesetzt. Indikationen zur Antikoagulantientherapie sind u.a. Beinvenenthrombosen, Lungenembolie, Herzinfarkt, Vorhofflimmern, Herzklappenersatz und bestimmte Herzklappenfehler.
Bei zahnärztlich – chirurgischen Maßnahmen muss der Zahnarzt die besondere Blutungsgefahr, die bei einem „Marcumar" – Patienten besteht, beachten (Abb. 1).
#Abb. 1#
Die interforaminale Implantation erfolgte bei der Patientin ohne Berücksichtigung der erhöhten Blutungsneigung. Das Ausmaß der Gerinnungshemmung und somit auch der Blutungsgefahr wird durch den Quickwert oder Varianten wie den Thrombotest angezeigt. Der Normalwert für beide Tests beträgt 100% mit einem Normalbereich von ca. ± 25%. Der therapeutische Bereich, d.h. der Bereich der gewünschten Gerinnungshemmung liegt für den Quicktest zwischen 15 und 25%.
Bei umfangreichen Gebisssanierungen oder Operationen mit ungenügender Möglichkeit der lokalen Blutstillung ist eine vorübergehende Anhebung des Quickwertes auf 30 bis 40% angezeigt – 1,6-1,9 INR (International Normalized Ratio). In Zweifelsfällen sind Patienten mit ausgedehnten zahnärztlich-chirurgischen Eingriffen stationär zu behandeln, da unter Umständen durch Verminderung der Antikoagulantien Risiken entstehen können. In diesen Fällen erlaubt die über einen Perfusor gesteuerte Heparingabe sowohl das Thromboserisiko weitgehend auszuschalten wie auch durch kurzfristiges Sperren der Heparinzufuhr eine intraoperative Blutung oder eine akute postoperative Nachblutung zu beherrschen.
8 Behandlungen in der Schwangerschaft
Die Schwangerschaft erfordert die Berücksichtigung einiger spezifischer ärztlicher und rechtlicher Belange, um eine Gefährdung oder Schädigung des ungeborenen Lebens zu vermeiden. Darüber hinaus sind die physischen und psychischen Besonderheiten der Schwangeren zu beachten [21].
8.1 Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen
Die Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen befasst sich in §22 Absatz 1 Nr. 2, Absatz 2, §25 Absatz 2 und §28 mit den Besonderheiten der Anwendung ionisierender Strahlen bei weiblichen Personen im gebärfähigen Alter und in der Schwangerschaft [17]. Obwohl es als erwiesen gilt, dass eine pränatale Strahlenexposition, in Abhängigkeit von der Dosis und vom Gestationsalter, zum Tod der Leibesfrucht, zu Missbildungen, Wachstumsstörungen, malignen Erkrankungen sowie genetischen Veränderungen führen kann, wird das Risiko zahnärztlicher Aufnahmen bei Beachtung eines optimalen Strahlenschutzes als extrem niedrig eingestuft. Die Strahlenbelastung im Bereich des Uterus wird bei Aufnahmen im Mund-Kiefer-Bereich in der Größenordnung der natürlichen Hintergrundbelastung zwischen 0,1-1 pGy [Neue Einheit der absorbierten Dosis – Energiedosis, das Gray = 1 rd oder Rad (Radiation absorbed dose = alte Einheit). 1 Gy =1 J/kg = 100 rd. Joule (J) = Einheit der Energie] geschätzt. Wegen Unkenntnis einer sicheren Schwellendosis sollten jedoch Röntgenuntersuchungen in der Schwangerschaft nur bei zwingender Indikation durchgeführt werden; dies gilt insbesondere für das 1. Trimenon. Um die Strahlenbelastung möglichst gering zu halten, sollten höchstempfindliche Filme, Rechtecktubus sowie Mehrfachröntgenschutz verwendet werden. Die Zahl der Aufnahmen ist auf ein Minimum zu beschränken, auf besondere Maßnahmen des Strahlenschutzes sollte geachtet werden.
8.2 Toxizität von Amalgamfüllungen
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte [BfArM (1997)] erkennt derzeit keinen begründeten Verdacht für embryo- oder fetotoxische Risiken durch Quecksilber aus den Amalgamfüllungen während der Gravidität, empfiehlt jedoch, keine weitere Amalgamtherapie während der Schwangerschaft, wie allgemein bei Frauen im gebärfähigen Alter üblich, durchzuführen, da experimentelle und klinisch-epidemiologische Untersuchungen gezeigt haben, dass Quecksilber transplazentar auf das ungeborene Kind übertragen wird.
Auch die Übertragung von Quecksilber aus Amalgamfüllungen durch die Muttermilch auf den Säugling wurde nachgewiesen. Eine schwedische Studie bei 30 Müttern sechs Wochen nach der Entbindung zeigte, dass es eine Übertragung von anorganischem Quecksilber aus dem Blut in die Milch gibt, wobei die Milchquecksilberexposition an das Kind etwa die Hälfte der von der WHO festgelegten zulässigen täglichen Einnahme für Erwachsene betrug [15].
8.3 Verordnung von Medikamenten
Während die Medikamentenwirkungen auf die Mutter bekannt sind, ist die Risikoabschätzung von Medikamentenwirkungen auf das werdende Leben schwierig. Die Art der Schädigung ist von der intrauterinen Entwicklungsphase abhängig. Die Verantwortung für die Arzneimitteltherapie in der Schwangerschaft trägt vor allem der behandelnde Zahnarzt.
8.3.1 Antibiotika
Bei den folgenden Antibiotikagruppen wurden keine embryotoxischen Wirkungen festgestellt:
- Penicilline
- Cephalosporine
- Makrolid-Antibiotika.
8.3.2 Analgetika
Unter Berücksichtigung einiger Besonderheiten ist das Anilinderivat Parazetamol und Phenazon bzw. Propyphenazon für die Anwendung in der Schwangerschaft geeignet. Hinweise auf teratogene Wirkungen liegen nicht vor. Paracetamol passiert die Placenta, weshalb eine hohe Dosierung über längere Zeit zu vermeiden ist, um kindlichen Leberschäden vorzubeugen.
Acetylsalicylsäure hemmt die Prostaglandinsynthese und sollte deshalb im letzten Schwangerschaftsmonat zur Vermeidung einer Geburtsverzögerung nicht verordnet werden. Bei Schwangeren und Feten werden Blutungen beobachtet; daher sollte Acetylsalicylsäure in der Schwangerschaft vermieden werden (Cave: Vorzeitiger Verschluss des Ductus Botalli).
In besonderen Schmerzsituationen mit starken Schwellungen kann die Anwendung von Derivaten schwacher Carbonsäuren erwogen werden, die zu den nichtsteroidalen Antirheumatika zählen. Diese sind Arylessigsäuren und Arylpropionsäuren. Die bekanntesten Vertreter sind Diclofenac und Ibuprofen.
In besonderen Fällen ist die Anwendung von Opiaten und sogenannten Opioidanalgetika, die zum Teil der Betäubungsmittelverordnung unterliegen, geboten. Hinweise auf ein Missbildungspotenzial finden sich nicht. Allerdings beruhen die Erfahrungen auf einer sehr schmalen Datenbasis. Bei der Anwendung kurz vor der Geburt kann beim Neugeborenen eine Atemdepression auftreten. Die lange Anwendung von Opiaten kann beim Neugeborenen Entzugserscheinungen und Reaktionsverzögerungen hervorrufen.
8.3.3 Sedativa und Hypnotika
In Einzelfällen müssen Anxiolytika kurzzeitig verordnet werden, selten auch Schlafmittel. Besonders geeignet ist bei strenger Indikationsstellung hierfür die Gruppe der Benzodiazepine wegen der geringen Nebenwirkungsrate. Diazepam ist die am besten untersuchte Verbindung dieser Gruppe. Es kann bei einer zahnärztlichen Indikation in der Regel als Anxiolytikum und Hypnotikum eingesetzt werden.
8.3.4 Lokalanästhetika
Lokalanästhetika besitzen eine hohe Lipidlöslichkeit und können deshalb schnell die Plazenta passieren. Der Übertritt vom mütterlichen in das fetale Blut erfolgt um so rascher, je geringer das Lokalanästhetikum an Plasmaproteine gebunden ist. Es werden deshalb die Lokalanästhetika mit der höchsten Proteinbindungsrate bevorzugt. Es gibt keine Berichte über keimschädigende Wirkungen durch Lokalanästhetika bei der zahnärztlichen Behandlung von Schwangeren. Adrenalin als vasokonstriktorischer Zusatz ist in der Schwangerschaft möglichst niedrig zu dosieren (1:200.000). Vonseiten der Gynäkologen bestehen keine Einwände gegen Adrenalin-Abkömmlinge; diese Stoffe werden als Tokolytika (Wehenhemmende Arzneimittel) eingesetzt. Intravasale Applikation ist zu vermeiden, da systemisch resorbiertes Adrenalin durchaus zu einer Konstriktion der Uterusgefäße führen kann. Noradrenalin und Felypressin sind kontraindiziert. Während der gesamten Schwangerschaft können die folgenden Lokalanästhetika verwendet werden:
- Articain
- Bupivacain
- Etidocain.
Die Amide Prilocain und Mepivacain sind eher kritisch zu betrachten.
9 Schlussbemerkungen
Gerichtliche Auseinandersetzungen zwischen Zahnärzten und Patienten nehmen leider zu. Die Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen gelingt leider auch oft, weil formelle Versäumnisse in Praxis und Klinik häufiger werden und die von den Kammern gebotenen Schulungsmöglichkeiten ungenutzt bleiben. Solange man in der Ausbildungsordnung des Studienganges Zahnmedizin vergebens nach Hinweisen auf das Gebiet der forensischen Zahnmedizin, das auf der Zusammenarbeit mit dem Zahnarzt in Praxis und Klinik basiert, sucht, sollte sich jeder Zahnarzt in Eigeninitiative mit den Grundzügen der Thematik befassen. Der Einblick in relevante Fragen soll dazu beitragen, bestehende Unsicherheiten zu verringern und eine realistischere Einschätzung der eigenen Situation ermöglichen, die der Gutachter dem Gericht interpretiert. Der Gutachter als Sachverständiger oder als Sachverständiger Zeuge hat als neutrale Person die Möglichkeit, klärend dem Richter zuzuarbeiten und er kann mit dazu beitragen, die oft fatalen Folgen eines fehlgeleiteten Anspruchsdenkens vermeintlich fehlbehandelter Patienten zu vermeiden, aber auch die Rechte des Behandlers wahrzunehmen.
Anhang
Patientenerhebungsbogen
Literatur
1 Bräutigam, W., Christian, P., Rad, M.: Psychosomatische Medizin. Thieme Stuttgart (1992).
2 Dajani, A.S., Taubert, K.A., Wilson, W., Bolger, A.F., Bayer, A., Ferrieri, P., Gewitz, M.H., Shulman, S.T.T., Nouri, S., Newburger, J.W., Hutto, C., Pallasch, T.H.J., Gage, T.W., Levinson, M.E., Peter, G., Zuccaro, G.: Prevention of bacterial endocarditis – Recommendation by the American Heart Association JAMA 277: 1794-1801 (1997).
3 Glauser, M., Bernard, B.: Successful single-dose amoxcillin prophylaxis against experimental streptococcal endocarditis. Evidence of two mechanisms of protection. J Infect Dis 147: 568 (1983).
4 Gümpel, G.: Rechtliche Bedeutung prophylaktischer Maßnahmen und Haftungsrisiko des Zahnarztes. AKFOS Newsl Jg 1,1: 13 (1994).
5 Horstkotte, D.: Mikrobiell verursachte Endokarditis: Klinische und tierexperimentelle Untersuchungen. Steinkopff Darmstadt, S 149 (1995).
6 Horstkotte, D.: Zahnärztliche Eingriffe und Endokarditis-Prophylaxe. Stellungnahme der DGZMK (1999).
7 Knirsch, W., Finke, Ch., Adam, M., Vogel, M., Lange, P.E.: Der Risikopatient. So erkennen Sie und schützen Sie Ihren Endokarditis-Risikopatienten. Zahnärztliche Mitteilungen (1999).
8 Lechler, E., Pape, H.D.: Zahnärztlich – chirurgische Behandlung von „Marcumar" – Patienten. Stellungnahme der DGZMK 3/96, Stand 13.07.1996 (1996).
9 Machten, E., Lemke, B., Irnich, W.: Die zahnärztliche Behandlung von Patienten mit Herzschrittmachern. Stellungnahme der DGZMK 1/96, Stand 28.05.1996 (1996).
10 Malinverni, R., Overholser, C.D., Bille, J., Glauser, M.: Antibiotic prophylaxis of experimental endocarditis after dental extractions. Circulation 77: 182-187 (1988).
11 Martin, M.V., Butterworth, M.L., Longman, L.P.: Infective endocarditis and the dental practitioner: a review of 53 cases involving litigation. Br Dent J 182: 465-468 (1997).
12 Marxkors, R.: Ursachen und Therapie von Prothesenintoleranz. Dtsch Zahnärztl Z 50: 704 (1995).
13 Marxkors, R.: Ursachen, Auswirkungen und Behebungen von Mißerfolgen. Dtsch Zahnärztl Z 54: 600-610 (1999).
14 Marxkors, R., Wolowski, A.: Unklare Kiefergesichtsbeschwerden. Hanser München Wien (1999).
15 Oskarsson, A., Schultz, A., Skerfving, S., Hallen, I,P,, Ohlin, B., Lagerkvist, B.J.: Total and inorganic mercury in breast milk in relation to fish consumption and amalgam in lactating women. Arch Environ Health 51: 234-241 (1996).
16 Otten, J.E.: Zahnsanierung vor und nach Organtransplantation. Stellungnahme der DGZMK. Zahnärztl Mitt 88, 24: 43-45 (1998).
17 Peinsipp, N., Roos, G., Weimer, G.: Röntgenverordnung RöV, 5. neu bearb. Aufl. Forkel, Hüthig Heidelberg, S. 168-183 (2003).
18 Rötzscher, K.: Haftungsrisiken bei zahnärztlicher Behandlung. In: Rötzscher, K. (Hrsg.) Forensische Zahnmedizin, Books on Demand Norderstedt, S. 25-31 (2003).
19 Vetter, Ch.: Typ-II-Diabetes: „Alterszucker“ schon bei Kindern. Neue Erkenntnisse für die Kinderbehandlung. Zahnärztl Mitt 89,14: 26-27 (1999).
20 Wahl, G.: Zahnärztlich-chirurgische Eingriffe bei Diabetikern. Stellungnahme der DGZMK 4/96, Stand 6.9.1996 (1996).
21 Willershausen-Zönnchen, B.: Zahnärztliche Behandlung in der Schwangerschaft. Stellungnahme der DGZMK 8/94, Stand: 28.02.1994 (1994).
Dr. med. Dr. med. dent. Klaus Rötzscher
Studium der Medizin und Zahnmedizin in Leipzig, Pathologe, Rechtsmediziner. Zahnarzt in eigener Praxis in Speyer/Rhein (1977 – 1998).Vorsitzender des interdisziplinären Arbeitskreises für Forensische Odonto-Stomatologie (AKFOS) der Deutschen
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und der Deutschen
Gesellschaft für Rechtsmedizin. Buchautor.